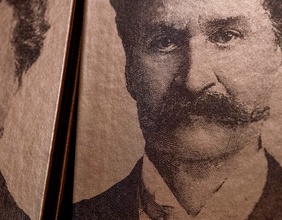2,7 Milliarden gegen die Krise
Die Steuerreform 2009
Als Noch-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer im Frühjahr gefordert hat, die Steuern sollten ab 2009 gesenkt werden, wollte die ÖVP nichts davon wissen. Es brauchte eine Wahlniederlage und eine Wirtschaftskrise, um die Volkspartei umzustimmen.
8. April 2017, 21:58
Die Österreicherinnen und Österreicher werden im kommenden Jahr weniger Steuern zahlen. Das ist eines der konkreten Ergebnisse, auf die sich SPÖ und ÖVP in den Koalitionsverhandlungen geeinigt haben. 2,2 Milliarden Euro wird der Staat 2009 weniger an Lohn- und Einkommenssteuer einnehmen. Dazu werden Familien mit Kindern in Summe 500 Millionen Euro mehr bekommen. Soweit so erfreulich. Die Frage ist aber, ob der einzelne die Reform tatsächlich spüren wird, ob er tatsächlich mehr Geld zur Verfügung haben und es auch ausgeben wird.
Die Wirtschaftskrise macht’s möglich
Monatelang haben SPÖ und ÖVP über die Steuerreform gestritten. Als Noch-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer im Frühjahr gefordert hat, die Steuern sollten ab 2009 gesenkt werden, wollte die ÖVP nichts davon wissen. Sie war gegen eine Steuerreform auf Pump, wie sie es nannte. Es brauchte eine Wahlniederlage und die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, um die Volkspartei umzustimmen.
Jetzt kommt sie doch 2009, und wohl zum größten Teil auf Pump, sprich auf Kosten höherer Staatsschulden. Denn die Regierung verspricht, sie will den Ausfall bei Lohn- und Einkommenssteuer nicht ausgleichen, indem sie andere Steuern erhöht.
2,7 Milliarden Euro macht die Reform in Summe aus - viel Geld für das Staatsbudget, und auch der einzelne Steuerzahler sollte etwas davon spüren. Eine Frau, die zum Beispiel 1.700 Euro brutto verdient und zwei Kinder alleine erzieht, erspart sich 140 Euro im Monat. Sie zahlt rund 500 Euro weniger Einkommenssteuer pro Jahr und erhält 1.200 Euro aus dem Familienpaket. Eltern, die gemeinsam 5.000 Euro brutto verdienen und ebenfalls zwei Kinder erziehen, haben um 207 Euro mehr zur Verfügung.
Kinderbetreuung wird absetzbar
Beim Familienpaket hat die ÖVP eine seit langem erhobene Forderung durchgesetzt: Kinderbetreuung wird steuerlich absetzbar. Betreuungskosten von höchstens 2.300 Euro für Kinder bis zum 10. Lebensjahr können Eltern in Zukunft von der Steuer absetzen. Darüber hinaus wird der Freibetrag für Kinder erhöht, ebenso wie der fixe Absetzbetrag.
Außerdem senkt die Regierung die Steuersätze. Der Eingangssteuersatz macht in Zukunft 36,5 Prozent aus, bisher sind es 38,3 Prozent. Die Grenze für steuerfreie Einkommen wurde von jährlich 10.000 auf 11.000 Euro angehoben. Der mittlere Steuersatz für Einkommen ab 25.000 Euro wird nur leicht gesenkt, von 43,6 auf 43,2 Prozent. Der Spitzensteuersatz bleibt bei 50 Prozent. Allerdings wird er erst ab einer Grenze von 60.000 Euro wirksam, derzeit sind es 50.000.
Zweifel am Konsumschub
Die Regierung hofft, dass die Steuerzahler das Geld, das ihnen bleibt, vermehr ausgeben werden. Experten bezweifeln, ob dieser Effekt eintreten wird. Bernhard Felderer, Leiter des Instituts für Höhere Studien, meint, es würde mehr bringen, wenn die Menschen noch heuer eine Entlastung spüren. Tritt der Effekt erst nächstes Jahr, mitten in der Krise, ein, könnten viele dazu neigen, das Geld zu sparen.
Die Industriellenvereinigung bemängelt, dass die Steuerreform zu kurz greife. Gernot Haas, Steuerexperte der Industriellenvereinigung, beklagt, dass man in den vergangenen guten Wirtschaftsjahren kein Reserven geschaffen habe, die man jetzt im Angesicht der Krise gut brauchen könnte. Haas warnt auch davor, verstärkt Sozialleistungen über Steuern zu finanzieren. Das würde das Sozialsystem weniger treffsicher machen und das Steuersystem übermäßig belasten. Eine Kritik, die man im Gewerkschaftsbund nicht nachvollziehen kann. Im ÖGB sieht man eine Steuersenkung, aber keine große Reform.
Wifo vermisst große Perspektiven
Diese Kritik teilt auch Margit Schratzenstaller, Budgetexpertin am Institut für Wirtschaftsforschung. Sie verlangt, dass das Steuersystem gründlich reformiert werde. Die jetzige Steuersenkung trifft nur einen Teil der Bevölkerung. Rund 2,5 Millionen Menschen in Österreich verdienen so wenig, dass sie gar keine Steuern zahlen. Schratzenstaller verlangt, dass auch Menschen entlastet werden, die wenig verdienen. Das gehe nur, wenn man die Beiträge zur Sozialversicherung kürze. Das würde auch die so lange geforderte Entlastung des Faktors Arbeit bringen.
Verglichen mit anderen Ländern sind in Österreich die Steuern auf Arbeitseinkommen besonders hoch. Ökosteuern, also Steuern auf Energie oder Vermögenssteuern seien viel niedriger als in anderen Ländern, sagt Wifo-Expertin Margit Schratzenstaller. Höhere Steuern für Umweltbelastungen oder auf Vermögen würden es ermöglichen, Lohn- und Einkommenssteuer oder Sozialversicherungsabgaben weiter zu senken.
Auch die neue Regierung scheint zu wissen, dass es mit der Steuerreform 2009 nicht getan ist. Im Koalitionsabkommen hat sie sich nämlich darauf geeinigt, gleich wieder eine Kommission einzurichten. Deren Aufgabe ist - eine Steuerreform.
Hör-Tipp
Saldo, Freitag 28. November 2008, 9:45 Uhr
Links
WIFO
IHS
BMF
Arbeiterkammer