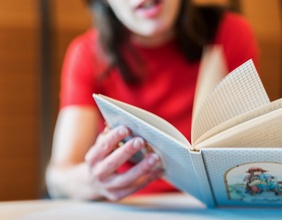Am Ende des Belcanto
Mercadantes "Virginia"
Saverio Mercadante, der Komponist des heute noch erfolgreichen "Giuramento", war Rossini-Zeitgenosse, hat aber noch komponiert, als Verdi bereits ans Aufhören dachte. Eine Neuaufnahme macht endlich seine letzte Oper "Virginia" hörbar.
8. April 2017, 21:58
Im Anschluss an die Uraufführung von Saverio Mercadantes "Virginia" 1866 bringt der greise Francesco Florimo, in die Musikgeschichte eingegangen als Freund des damals längst verstorbenen Bellini, "Virginia"-Impressionen zu Papier. Er findet die Mercadante-Oper zwar lobenswert, doch "lärmend": Dass nicht nur die deutsche, sondern auch die italienische Oper des 19. Jahrhunderts immer Orchester-lastiger wird, muss einem, der Bellini über alles liebte, besonders auffallen. Große, starke Stimmen sind nun gefragt, und die Kraft der Stimmproduktion ist Teil der Operndramatik geworden.
Bald werden die Sängerinnen und Sänger am Scheideweg stehen: wenn sich diese Kraft und ornamentales Singen nicht mehr vereinbaren lassen und die Koloraturen, die Mercadante in "Virginia" noch genauso verlangt wie der mittlere Verdi in seinen Opern, gänzlich auf der Strecke bleiben müssen.
So ist die koloraturgespickte, aber aus dem Rahmen fallende Cabaletta von Mercadantes "Virginia" ein Gegenstück zum ersten Finale von Verdis "La Traviata": gemessen am Stimmgewicht, das der Sopranistin im Rest der Oper abverlangt wird, von ihr schon fast nicht mehr zu bewältigen. Und so steht Saverio Mercadantes "Virginia" genau an dem Punkt, an dem sich der "Belcanto" überlebt.
Der Rossini-Zeitgenosse als Verdi-Konkurrent
In den 1810er Jahren hatte Saverio Mercadante, schon aktiv als Opernkomponist, noch Rossinis Aufstieg miterlebt. Als 1866 in Neapel Mercadantes "Virginia" ihre Uraufführung erlebte, war ihr Komponist ein dem Theateralltag entrückter Altmeister, und Giuseppe Verdi ein Mitt-50er, der den Pariser "Don Carlos" vorbereitete und an endgültigen Rückzug dachte. Faszinierend, anhand einer Neuaufnahme der "Virginia" zu beobachten, wie sich in Mercadantes über 50 Bühnenwerken das Konzept des "Belcanto" verändert hat und zuletzt das "melodramma" nach Verdi-Art die Oberhand gewinnt.
Vom Plattenlabel Opera Rara kommt diese Aufnahme mit dem Geoffrey-Mitchell-Choir und dem London Philharmonic Orchestra unter Maurizio Benini, mit Susan Patterson, Paul Charles Clarke und Charles Castronovo in den Hauptrollen.
Im Visier der neapolitanischen Zensur
Ein Kuriosum: Entstanden ist "Virginia" schon 15 Jahre vor der Uraufführung. 1849 begann Librettist Salvatore Cammarano mit dem "Virginia"-Text, 1851 schloss Komponist Saverio Mercadante die Partitur ab, ein Termin für die Premiere am Teatro San Carlo in Neapel war fixiert. Schuld an ihrem Nichtzustandekommen war das strikte "Nein" der neapolitanischen Zensur: ein "Nein" zu einer Opernhandlung rund um den durch absolute Macht absolut korrumpierten Appius Claudius im 5. vorchristlichen Jahrhundert, mit der Monarchen der Gegenwart nicht froh werden konnten.
Appio (wie er in der Oper heißt) schaltet sämtliche Konkurrenten aus, hält die Plebejer in Knechtschaft, ist aber in die Plebejerin Virginia, Tochter eines ehrenhaften Berufssoldaten, vernarrt. Zum Zug kommt er nicht, denn Virginia liebt Icilio, einen früheren Plebejer-Tribunen, den Appio politisch bereits ausgeschaltet hat. Zwei Opernakte dauert es, dann endet das Duell dieser zwei Tenöre um die Sopranistin Virginia mit Icilios Ermordung.
Abgefeimte Intrige
In einer abgefeimten Intrige will Appio nun - um Liebe geht es längst nicht mehr - Virgina als gewesene Sklavin brandmarken lassen, um auf sie ungehindert Zugriff zu haben. Virginias Vater, dem solche Entehrung unerträglich wäre, ersticht die Tochter daraufhin in aller Öffentlichkeit und löst so einen Aufstand gegen Appio aus.
Im Finale der Oper wird Appio vom aufgebrachten Volk gelyncht. In einer Stadt, in der es 1848 gegen die regierenden Bourbonen gegangen war, konnte ein solches Stück nicht auf die Bühne kommen. Verdi war längst so berechnend, "kritische" Opernstoffe nur in Oberitalien zu lancieren, Mercadante aber so charakterfest, keine Note und keinen Beistrich an "Virginia" zu ändern.
Uraufführung nach 15 Jahren
Als 1866 endlich die Zeit für die Uraufführung der "Virginia" gekommen war, in einer alles andere als prachtvollen Premiereninszenierung am San Carlo, fiel der Erfolg mehr pietätvoll als rauschend aus. Ein rührendes Bild war es: der seit Jahren erblindete, alte Komponist in seiner Loge, der versuchte, Fassung zu bewahren, obwohl ihm die Tränen herunter rannen, und der ungelenk die Hände in Richtung des ihm zujubelnden Publikums ausbreitete
Nennenswertes Bühnen-Weiterleben war der "Virginia" nach den paar Aufführungen in Neapel trotzdem nicht vergönnt. Für die Opern-Gegenwart standen, zumal nach Mercadantes Tod 1870, vor allem Verdi, Amilcare Ponchielli, auch Enrico Petrella und Antonio Carlos Gomes. Rossini, Donizetti, Pacini, Mercadante - schon von gestern.
Großes Pathos, große Melodie
Und wie klingt nun diese "Virginia"? In den Chorszenen jedenfalls wie bester Verdi der "risorgimento"-Opern oder des "Macbeth". Den Appio stattet Mercadante mit der perfiden Eleganz von Verdis Herzog von Mantua aus, was daran erinnert, dass "Virginia", hätte das geplante Uraufführungsdatum 1851 gehalten, eine Jahrgangskollegin des "Rigoletto" gewesen wäre.
Dazu passt, dass Saverio Mercadante die Rolle der Virginia ursprünglich für jene Eugenia Tadolini geschrieben hat, die Donizettis erste Linda di Chamounix und erste Maria di Rohan gewesen war, die dann aber auch Verdi sang: Alzira, Ernani-Elvira und Odabella in "Attila", Rollen, die den Belcanto-Rahmen ebenfalls schon sprengten.
Aus der Tenöre-Sopran-Dreiecksgeschichte schlägt Mercadante alle denkbaren Funken aufgeheizter Operndramatik, im Finale gehen großes Pathos und große Melodie Hand in Hand, und in einigen Episoden der "Virginia" ist es nur mehr ein winziger Schritt zum wollüstigen Effektmusizieren eines Ruggero Leoncavallo. "Virginia": die reife Frucht einer zu Ende gehenden Ära.
Hör-Tipp
Apropos Oper, Donnerstag, 9. Juli 2009, 15:06 Uhr
CD-Tipp
Mercadante, "Virginia", London Philharmonic Orchestra, Maurizio Benini, Opera Rara