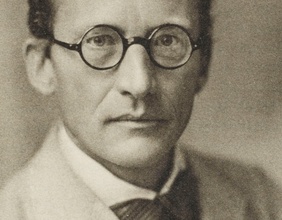Komponierbares
Schiller und die Musik
Es war Goethe, der den Geruch fauler Äpfel als Inspirationsquelle Schillers publik gemacht hat, tatsächlich aber wurde der Dichter des "song of joy" öfter durch das "Anhören trauriger oder lebhafter Musik" poetisch stimuliert.
8. April 2017, 21:58
Das Schiller-Jahr 2009 ist ein Anlass, sich auch mit der Vertonbarkeit von Schiller-Texten, aber auch mit der Komponierbarkeit der Schiller'schen Ideologien auseinanderzusetzen. Das wird man besser nicht nur am Beispiel Beethovens tun, weil dafür manche genuine Opernkomponisten, wie etwa Verdi weit bessere Beispiele liefern können.
Literaturkenner Verdi
Trotz seiner lebenslangen Verehrung für Shakespeare und den beiden späten Meisterwerken Othello und Falstaff, hat Verdi mehr Stoffe Schillers vertont als von jedem anderen Dichter der europäischen Theatergeschichte.
Es hängt wohl ganz einfach mit zwischenmenschlichen und künstlerischen Kontakten zusammen, dass er in seinem Frühwerk, in seinen Galeerenjahren bis zum "Rigoletto", stärker zu Schiller tendierte, und in seinem Alter - nach der Aida - dann von Arrigo Boito nochmals - wider eigener Erwartungen - durch Shakespeare inspiriert wurde. Den Shakespeare-Experten Boito hat Verdi erst spät in seiner Karriere kennen gelernt, den Schiller Übersetzer Andrea Maffei schon in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts.
Verdis Kapuziner
Auf dieser Bekanntschaft basiert nicht nur "Luisa Miller", der erste Schiller-Erfolg Verdis, immerhin hat er insgesamt vier Dramen des renommierten deutschen Dramatikers in Opern verwandelt (auch "Giovanna d'arco", "I Masnadieri" und "Don Carlos") und darüber hinaus einen Schiller-Text in seine "Macht des Schicksals" integriert: Jene Kapuzinerpredigt, für deren Konzeption Goethe die Werke des Wiener Predigers Abraham a Sancta Klara an Schiller gesandt hatte. Und die zuletzt im Wiener Burgtheater gestrichen worden ist. Verdi hat sie seinem Fra Melitone in den Mund gelegt.
Schillers Musikgeschmack
Wenn er auch den leeren Prunk vieler Barockopern hasste, die dem höfischen Geschmack des Theaterpublikums in Ludwigsburg, wo der junge Schiller die ersten Begegnungen mit der Oper erleben konnte, entsprachen, wenn er auch grundsätzlich keine große Sympathie für die Form der Oper hegte und in der biographischen Literatur manchmal auch als unmusikalisch bezeichnet wird, (wohl weil Schiller - im Gegensatz zu Goethe, der Hausmusikabende liebte und selbst gerne Klavier spielte - kein Instrument beherrschte,) so ist doch zumindest Schillers Sprache oft von musikalischen Elementen durchsetzt.
Man denke nur an den rhythmischen Schwung vieler seiner Gedichte oder Balladen. Auch an manche klangmalerische Wirkung. An das intensive sprachliche und an das inhaltliche Crescendo dramatischer Monologe. Und an seine komplizierten dramaturgischen Strukturen, die etwa im "Don Carlos" wie ein polyphones Gewebe empfunden wurden, das in Bezug auf die Ideen, die er etwa im Wallenstein je nach den Personen, die sie artikulieren, verschieden beleuchtet - und damit sozusagen verbal uminstrumentiert. Ein Verfahren, worin er einmal mit Beethoven verglichen wurde.
Musik der Worte
Im Jahre 1792 schrieb Schiller an Körner: "Das Musikalische eines Gedichtes schwebt mir weit öfter vor der Seele, wenn ich mich hinsetze, es zu machen, als der klare Begriff vom Inhalt".
Und wenige später(1796) äußert er sich in einem Brief an Goethe ähnlich: "Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Gemütsstimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee".
Altmodische Dichter
Aber ähnlich wie bei Goethe schien sein musikalische Geschmack - auch bei der Beurteilung von Vertonungen seiner Gedichte - eher rückständig als fortschrittlich gewesen zu sein: Strophenlieder zog er der durchkomponierten Form vor. Der Komponist, dessen Bewunderung durch Schiller am klarsten dokumentiert ist, war der fast ein halbes Jahrhundert ältere Gluck, dessen "Iphigenie auf Tauris" ihm "einen unendlichen Genuss verschafft hat".
Aber als ihn Goethe im Jahr 1800 einlud, ein Probe der "Iphigenie auf Tauris" zu besuchen, lehnte Schiller ab: "Ich habe, wie sie wissen, in Angelegenheiten der Musik und Oper so wenig Kompetenz und Einsicht, dass ich ihnen mit meinem besten Willen und Vermögen bei dieser Gelegenheit wenig taugen werde. Besonders, da man es in Opernsachen mit sehr heiklichten Leuten zu tun hat."
Wie weise, und wie wenig zeitgebunden - selbst in solchen Nebensächlichkeiten!
Haydn-Verächter
Für den ebenfalls viel älteren Zeitgenossen Joseph Haydn, vor allem für dessen Alterswerk, brachte Schiller kein Verständnis auf. Die "Schöpfung" hat er in einem Brief an Körner als "charakterloses Mischmasch" bezeichnet.
Da entsprach der Dresdner Hofkapellmeister Johann Gottlieb Naumann eher seinem Musikgeschmack. Für den wollte er sogar ein Libretto schreiben. Die Vertonung seiner Ballade "Der Taucher" durch Goethes Freund Zelter schätze er sehr und mit Goethe selbst hat er gelegentlich sogar musikalische Fragen diskutiert, wie die folgende Bemerkung Goethes nach einer Aufführung von Mozarts "Don Giovanni" im Jahr 1797 zeigt, die Goethe schon, Schiller aber nicht besucht hatte: "Ihre Hoffnung, die Sie von der Oper hatten nämlich dass aus ihr sich 'das Trauerspiel in einer edlern Gestalt' entwickeln würde, würden Sie neulich im 'Don Juan' auf einen hohen Grad erfüllt gesehen haben."
Hör-Tipps
Musikgalerie, jeden Montag, 10:05 Uhr
Radiokolleg - Freude, schöner Götterfunken!, Montag, 9. November bis Donnerstag, 12. November 2009, 9:45 Uhr
Patina - Kostbares aus dem Archiv, Sonntag, 15. November 2009, 9:05 Uhr; Sonntag, 22. November 2009, 9:05 Uhr; Sonntag, 29. November 2009, 9:05 Uhr
Übersicht
- Klassik