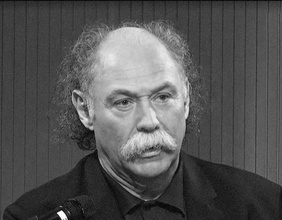Ein Haus und seine Geschichte
Die Lebenden und die Geister
Diane Meur beschreibt in ihrem neuen Roman das politische Geschehen und auch die Alltagskultur im 19. Jahrhundert. "Die Lebenden und die Geister" ist die lebendig und sehr ungewöhnlich erzählte Geschichte eines Jahrhunderts.
8. April 2017, 21:58
Auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine Familiensaga - ein Porträt von vier Generationen, das sich über ein Jahrhundert zieht. Doch diese Geschichte enthält einen ungewöhnlichen und wesentlichen Aspekt: Es ist ein Haus, das die Rolle des Erzählers übernimmt.
Ich bin im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts in Polen geboren, ein Kind der verschwenderischen Laune eines Grafen Ponarski (...). Maskenbälle, Kammermusik im englischen Garten, klassizistische Prachtentfaltung vor dem rauen Meer der galizischen Ebene: Alles erweckte den Anschein, als ginge es bis ans Ende der Zeiten so weiter. Sechzig Jahre später war Polen von seinen drei Nachbarn aufgeteilt worden und von der Karte Europas verschwunden; Graf Fryderyk war unter den Sensen seiner aufbegehrenden Leibeigenen umgekommen, und um seine Schulden zu begleichen, hatten seine Erben seinen Gutshof, den Dwór, sowie seine Ländereien und seine achtunddreißig Pferde verkaufen müssen.
Wieder im Familienbesitz
Der ehrgeizige Josef Zemka, ein Nachkomme des Grafen Ponarski, holt das Gut Anfang des 19.Jahrhunderts wieder zurück in den Familienbesitz. Dies gelingt ihm durch die Heirat mit der sensiblen und unscheinbaren Clara von Kotz. Sein gesellschaftlicher Aufstieg beginnt. Seine Ländereien und die familieneigene Zuckerfabrik bringen ihm Wohlstand. Einziger Wermutstropfen: Statt dem ersehnten männlichen Nachkommen bringt Clara fünf Töchter auf die Welt.
"Ich konnte mir vorstellen, dass ich Jozef war, obwohl er sehr unsympathisch ist, oder der Kutscher, oder... ja, alle", erzählt Diane Meur im Gespräch. "Und dieses Gefühl hab ich als Autorin, dass all diese Figuren in mir leben und Gespräche führen und einfach da sind und daher kommt vielleicht diese Idee des Hauses. Ja, für mich war das Haus auch eine Art Verräumlichung der Psyche oder des Gedächtnisses."
Wenn diese Wände reden könnten
Diane Meur lässt in ihrem Roman das Sprichwort "Wenn diese Wände reden könnten" wahr werden, denn das Haus weiß viel zu erzählen. Es beobachtet seine Bewohner, hört ihnen zu und versucht sich in sie hinein zu fühlen. Und mit den Bewohnern sind nicht nur die Menschen gemeint. So freut sich das Haus etwa über den Nachwuchs im Vogelnest am Dachboden. Oder lauscht den Sorgen der alten Kochtöpfe.
Zähle ich (...) alles zusammen, was ich mit meinen vielen Sinnen von Tieren, Menschen, Sesseln und Tassen erfahre, (...) was sich je in mir zugetragen hat, was in mir gesagt oder gedacht wurde, ist es wie eine gewaltige Symphonie, fühle ich mich voll, dass ich bersten könnte, und es kommt mir vor, als verstünde ich alles (...). Alles vereint sich zu einer einzigen großen Geschichte, in der die Mäuse im Keller keine geringere Rolle spielen, als die Grafen Ponarski oder die Zemka-Töchter.
"Das Haus ist kein allwissender Erzähler", ergänz Meur. "Manchmal erfindet das Haus eine Szene und danach muss es zugeben, dass es alles erfunden hat und das fand ich auch lustig. Ja, ich wollte das Haus als eine richtige Figur betrachten und behandeln."
Entwicklungen in Europa
Neben den menschlichen Schicksalen ist das Haus auch eine Art Chronist des politischen Weltgeschehens. Es berichtet über die Entwicklungen in der Habsburger Monarchie. Über den Wiener Kongress ebenso wie über die Revolutionen in Europa und den in diesem Zusammenhang stehenden polnischen Freiheitskämpfen.
Diane Meur hat übrigens keinen direkten oder familiären Bezug zu Polen. "Als ich diese Geschichte schon vorhatte und noch nicht genau wusste wo sie spielen sollte, hab ich mir gedacht: Polen, dieses Land, das plötzlich verschwindet und für 120 Jahre nicht mehr existiert, das ist gerade der Ort, wo diese Geschichte spielen muss, weil es ist auch eine Gespenstergeschichte", so Meur.
Zeit für Veränderung
Es sind die Gespenster der Vergangenheit, die das Haus und seine Bewohner einholen und denen sie sich nicht entziehen können. Der Aufstieg der Familie Zemka endet folgerichtig in ihrem Fall. Als Jozefs Urenkelin nach Amerika auswandert, beschließt auch das Haus, dass es Zeit für eine Veränderung ist. Welcher Art sei hier aber nicht verraten.
"Die Lebenden und die Geister" ist keine streng chronologische Erzählung. Diane Meur lässt ihren Ich-Erzähler oft abschweifen, Jahre vor und wieder zurück springen. Dazwischen schläft er - also das Haus - auch einmal für zwei Jahrzehnte.
Kenntnisreich beschreibt die Autorin sowohl das politische Geschehen als auch die Alltagskultur im 19. Jahrhundert. "Die Lebenden und die Geister" ist jedoch kein trockener Historienroman, sondern eine lebendig und sehr ungewöhnlich erzählte Geschichte eines Jahrhunderts.
Hör-Tipp
Ex libris, Sonntag, 29. November 2009, 18:15 Uhr
Mehr dazu in oe1.ORF.at
Buch-Tipp
Diane Meur, "Die Lebenden und die Geister", aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, Verlag Nagel & Kimche
Link
Nagel & Kimche - Die Lebenden und die Geister