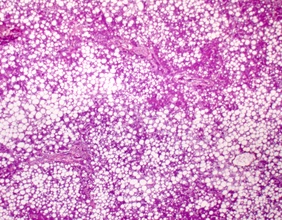Elf intensive Rufe
Drei, vier Töne, nicht mehr
Es sind elf intensive Anrufungen einer verlorenen Vergangenheit, einer Liebe, die abschiedslos zu Ende ging, die Andrea Winkler in ihrem Text versammelt. Winklers Prosa ist einmal mehr von hoher Musikalität und atemberaubender Einzigartigkeit.
8. April 2017, 21:58
Wer in der Musik zu Hause ist, möchte auch literarische Sätze als Klangfolge lesen, ihre Rhythmen spüren, ihren Variationen nachgehen. Und wie in der Musik nicht gleich nach einer Bedeutung oder gar einem erzählbaren Inhalt suchen. Niemand käme auf die Idee, Bachs Violinsonaten oder Bartóks Klavierkonzerte nachzuerzählen.
Wird aber über Literatur gesprochen, scheint die Vorstellung, es gäbe einen von der Form ablösbaren Inhalt nicht auszurotten. "Material" der Literatur ist ja die Alltagssprache, ihre Wörter und Sätze haben bereits eine Bedeutung, während ein Komponist Klangfolgen arrangiert, die für sich, außerhalb der Komposition, keine Bedeutung haben.
Monologe, die ein Du ansprechen
Sprachexperimentelle Autorinnen und Autoren haben versucht, den Zusammenhang mit der Alltagssprache zu durchkreuzen und ihre Sprache von den vorgegebenen Bedeutungen abzukoppeln. Schreibt ein Autor, eine Autorin jedoch in herkömmlichen Sätzen und gebraucht intakte Worte in ihrer üblichen Bedeutung, geht die Inhaltssuche schon los. Ein Zusammenhang, eine Geschichte, etwas Nacherzählbares wird erwartet.
Viele literarische Neuerer von einst sind längst auf dicke Romane eingeschwenkt, deren Inhalte sich referieren lassen, und die jüngere Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern hat in der Regel wenig Hemmung, das Geschichten-Bedürfnis zu bedienen. Dabei entstehen wenige Werke, die man lesen möchte wie Musik.
Andrea Winkler ist da eine Ausnahme. Ihre Monologe, die nicht monologisieren, sondern ein Du ansprechen und so Beziehungen erkunden, durchspielen und in Frage stellen, sind immer auch konsequent durchrhythmisierte Variationen von Sätzen, aber auch von Situationen und Konstellationen von Personen und Dingen. "Drei, vier Töne, nicht mehr" heißt ihr neuer Prosaband, der die musikalische Komponente ihres Schreibens erstmals im Titel nennt, dessen Variation sich durch den zweiten Text, besser gesagt: den zweiten Ruf zieht. "Elf Rufe" lautet der treffende Untertitel, denn es sind elf intensive Aufrufe und Anrufungen einer verlorenen Vergangenheit, einer Liebe, die abschiedslos zu Ende ging, und einer Beheimatung an genau lokalisierten Orten und in erinnerten Gesten.
Illusionslose Einsicht
Aus den Rufen ist der Nachklang all dessen zu vernehmen - das Wort "Nachklang" kehrt nicht nur im neunten Ruf leitmotivisch wieder. Aus diesem Ruf spricht die illusionslose Einsicht in die Gegenwart:
Nichts außer dieser Berührung jetzt, nichts außer diesem Hoffen jetzt. Nichts außer dem Gehen, Schritt um Schritt hin zum Baum, mit einem, der fehlt und lange noch fehlen wird, immer vielleicht, immer, immer vielleicht.
Doch die Einsicht kann umschlagen, der Adressat des Rufes sich ändern, und sein Tonfall auch. Der neunte Ruf endet mit der Frage:
Hörst du den Ton, der Tor um Tor öffnet für dich, der mich lockt, von der Schaukel zu springen, durch den Zaun zu schauen und in den Horizont ein Haus zu zeichnen, ein Floß, eine Wohnstatt für später?
Verschwimmende Grenze zwischen Imagination und Realität
Die beiden Zitate zeigen, wie diese Rufe zwischen verschiedenen Ansprechpartnern chanchieren: dem abwesenden Geliebten, der von Anfang an mit Sie, aber auch immer wieder mit dem vertrauten Du angesprochen wird; einem vorgestellten Publikum, aber auch dem eigenen Selbst der Sprecherin, denn immer wieder sind diese Rufe auch Selbstgespräche und vor allem gegen Ende hin auch Selbstvergewisserungen, die um die Erinnerung kämpfen, die sich selbst bestätigen, dass alles war wie es war - mit dem Effekt, dass einem beim Lesen die Grenze zwischen Imagination der Sprecherin und sogenannter Realität immer mehr verschwimmt.
Aber auch ein steinerner Löwe, dem die Augen verbunden werden, wird angesprochen. Immer wieder kreisen diese Rufe um ein kleines Inventar von Dingen: ein Glas auf der Treppe, dem Geliebten hingestellt; ein Bild an der Wand; eine Fensterbank oder ein Stein am Ufer. Sie sind wie Haltepunkte für die eruptive Erinnerung und Pflöcke, die den Sprachfluss in dem verankern, was außerhalb seiner existiert. Auch die Natur wird als Vergewisserung angerufen:
Ihr Wellen, du Sandgesträuch, ihr kleinen sinnlosen Steine, nährt mir die Gedanken, die hierher fliehen werden, einmal und immer wieder.
Kein Innehalten möglich
Die elf Rufe sind absatzlos durchgeschrieben und verweigern sich so der Lesepause, dem Innehalten; kurze Kursivpassagen sind das einzige Gliederungselement. Kein Zweifel, das ist keine Literatur, die man nebenbei lesen kann. Man braucht Ruhe, um in ihren Rhythmus einzuschwingen, denn der ist mindestens ebenso wichtig wie das, was gesagt wird; und um die Variationen der Sätze und Situationen gewahr zu werden. Sie werden in Gang gehalten vom Kampf um einen, der sich entzieht - eine ähnliche Konstellation wie in Andrea Winklers zweitem Buch "Hanna und ich", dessen Prosa vom Versuch in Gang gehalten wird, der sich entziehenden Hanna nahezukommen.
Jetzt freilich geht es um eine Frau-Mann-Beziehung. Dabei berührt der dritte Ruf tangential die Mann-Frau-Konstellation im Werk von Ingeborg Bachmann: Der Mann ist geprägt von Rationalität und Geschäft, die Frau erscheint für die Männerwelt als "verkehrt" und "nicht von dieser Welt". Auch die Versicherung: Ich "will nichts mehr für mich" ist ein Anklang an Bachmanns Gedicht "Böhmen liegt am Meer" – wie etwas später die Bachmann-Formel vom "Austritt aus der Zeit" auftaucht.
Mit dem Kampf der Frau um die Erinnerung und Selbstvergewisserung, um die Beziehung gegen das männliche Schweigen und Sich-Entziehen schreibt Andrea Winkler eine Konstante im Werk von Ingeborg Bachmann weiter. Auch in "Drei vier Töne, nicht mehr" muss das weibliche Ich darum kämpfen, nicht zum Verstummen gebracht zu werden.
Will er verschwinden, anderswo als ich? Und ganz und gar aus meinem Blickfeld? Dass ich weder Sie noch du sage, einfach gar nichts mehr? Und keine Stimme mehr höre, keine Stimme aus dem Gras Richtung Himmel, keinen Nachklang, dem ich antworte, in den ich mein Summen mische.
Täuschende Erinnerung
Die Selbstvergewisserung der Frau, ihr Kampf um die Erinnerung, ist auch ein Kampf darum, nicht zum Objekt gemacht zu werden:
Ich bin's, das Atmen, das Flüstern, das Hoffen, dass ich nicht nur Stoff für dich sei.
Doch die Konstellation ist so eindeutig nicht. Die elf Rufe dieses Prosabandes sind ja gerade auch durch ihre Widersprüche interessant, durch die Aufhebung dessen, was sich als sichere Erinnerung ausgibt. Wenige Seiten vor Schluss wird das besonders deutlich, wenn von einer Luke in der Mauer die Rede ist
(...) von wo aus ich die Bank sehe, auf der wir gar nie gewesen waren. Nur hingesetzt hab ich uns, weil es mir richtig schien, dass wir auf einer Bank sitzen, ins Wasser schauen und uns erinnern, dass einmal, einen Augenblick lang, ein klarer Vormittag war, ein Ruf auf den Weg (...)
Resonanzräume im Inneren
Wenn man sich einlässt auf Andrea Winklers Prosa, wird man nicht wissen, "wie es gewesen ist", wird man keinen Handlungsverlauf nacherzählen können. Dafür begegnet man noch einem Türhüter und streift mit diesem Wort an Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz". Vor allem aber bleiben einem Sätze, zu denen man noch einmal zurückkehren muss: Sätze von hoher Musikalität und atemberaubender Einzigartigkeit, die einen weit forttragen und die gleichzeitig viele Resonanzräume in einem selbst eröffnen. Das ist mehr, als man von einem Großteil der Bücher sagen kann, die heute hochgelobt und gerne gekauft werden.
Service
Andrea Winkler, "Drei, vier Töne, nicht mehr. Elf Rufe", Zsolnay Verlag
Hanser Verlage - Andrea Winkler