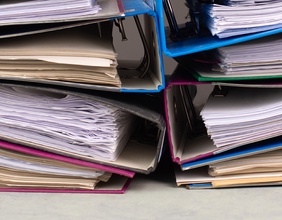Antikoloniale Erhebungen und ihre Folgen
Revolutionen in Lateinamerika
Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts waren eine bewegte Zeit für Lateinamerika: Mexiko wurde unabhängig, Kolumbien, Argentinien. Der Historiker Stefan Rinke vom Lateinamerika-Institut der FU Berlin geht diesen Ereignissen nun in einer umfangreichen Studie nach.
8. April 2017, 21:58
Gesellschaftliche Widersprüche
Die Spannungen zwischen der kreolischen, also bereits in den Kolonien geborenen Bevölkerung und der neu angekommenen europäischen Oberschicht traten in Lateinamerika schon früh zutage. Der deutsche Wissenschaftler Alexander von Humboldt, der Lateinamerika von 1799 bis 1805 bereiste, erkannte diesen gesellschaftlichen Widerspruch treffend. Er spricht sogar vom Hass, den die beiden Führungsschichten in den Kolonialreichen gegeneinander hegen.
In dem Maß, wie die Abkömmlinge der Europäer zahlreicher wurden als die, welche das Mutterland unmittelbar schickte, teilte sich die weiße Rasse in zwei Parteien, deren schmerzliche Nachgefühle nicht durch die Bande der Blutsverwandtschaft unterdrückt werden konnten.
Inspirierende Sklavenaufstände
Die erste wirklich revolutionäre Umwälzung in der Neuen Welt ereignete sich ab 1789 im Gefolge der Sklavenaufstände in der französischen Kolonie Saint-Domingue, dem Westteil der Karibikinsel Hispaniola. Die Aufstände endeten 1804 mit der Ausrufung der Republik Haiti.
Die Sklavenrevolution von Toussaint L'Ouverture erregte in ganz Amerika und Europa großes Aufsehen und heftige Diskussionen. Doch die teils hausgemachten, teils fremdbestimmten Schwierigkeiten, die nun auf den jungen Staat hereinstürzten, waren zu übermächtig. Haiti wurde kein dauerhaftes Beispiel für den antikolonialen Kampf, doch der siegreiche Aufstand der Sklaven wurde zur Inspiration für weitere Entkolonialisierungsbewegungen in Amerika und darüber hinaus.
Schicksalshafte Momente
Neu-Spanien war eines der vier Vize-Königreiche, in die die Kolonialmacht ihre lateinamerikanischen Kolonien eingeteilt hatte. Es umfasste Mexiko und Zentralamerika. Hier sollte der begüterte Dorfpfarrer Miguel Hidalgo aus der Ortschaft Dolores zur Schlüsselfigur des Aufstandes werden. Buchautor Rinke erinnert an jene schicksalshafte Geburtsstunde der mexikanischen Unabhängigkeit:
Am 16. September 1810 verlas er während des Gottesdienstes den berühmten 'Grito de Dolores', den Aufruf zum Aufstand gegen die schlechte Regierung und den guten König in Spanien.
Die Rebellion breitete sich nun wie ein Lauffeuer in der Kolonie aus. Doch die beiden Kriegsparteien bekämpften sich noch jahrelang mit wechselndem Glück. Erst im September 1821, elf Jahre nach dem "Schrei von Dolores", wurde die endgültige Unabhängigkeit Mexikos von Spanien ausgerufen.
Jahrelanger Freiheitskampf
Auch in anderen Regionen der Hemisphäre signalisierte das Jahr 1810 das Fanal zum Unabhängigkeitskrieg, auch wenn dieser oft erst Jahre später zum Ziel führte. In Venezuela bildete sich im April 1810 eine "Junta zum Erhalt der Rechte Ferdinands VII.", die trotz ihres patriotischen Namens die spanischen Amtsträger ins Mutterland zurückschickte. Hier trat erstmals der damals 27-jährige Kreole Simón Bolivar in Erscheinung, der spätere Held der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung.
In Kolumbiens Hauptstadt Bogotá bildete sich am 20. Juli - heute der Nationalfeiertag - des Jahres 1810 ein Oberster Rat, der den Unabhängigkeitsprozess einleitete. Die wirkliche Unabhängigkeit wurde aber erst im August 1819 durch Bolivar erkämpft.
"Der Erfolg wird unsere Anstrengungen krönen, denn das Schicksal Amerikas ist unwiderruflich festgelegt; das Band, das es mit Spanien vereinte, ist zerschnitten", war Simón Bolivar, dem sein Heimatland Venezuela den offiziellen Titel "Der Befreier" verliehen hatte, überzeugt. Dass seine Gegner eher in den eigenen Reihen zu finden waren als unter den Spaniern, wollte er längere Zeit nicht wahrhaben.
Interne Zwistigkeiten
Am schnellsten erfolgte die faktische Staatsgründung im südlichen Vize-Königreich La Plata. Dort hatten sich bereits 1809 die Gewichte zugunsten der nach Autonomie strebenden Kreolen verschoben. Deren Selbstbewusstsein war durch die erfolgreiche Abwehr zweier britischer Angriffe auf Buenos Aires 1806 und 1807 entscheidend gestärkt worden. Am 25. Mai 1810, dem heutigen Nationalfeiertag, wurde der spanische Vizekönig abgesetzt.
Wie bei anderen Unabhängigkeitsprozessen in Lateinamerika, so kam es auch in Argentinien bald zu internen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Interessen der Aufständischen.
Damit war allerdings noch nicht das Ende der Zwistigkeiten erreicht. Erst im Juli 1816 erließ der Kongress eine formelle Unabhängigkeitserklärung, die de facto schon seit Mai 1810 bestand.
Wiederkehrende Ideen
Die näheren Umstände der Staatsgründungen und unvollendeten Revolutionen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hinterließen in Lateinamerika offene Probleme, die teilweise bis heute noch nicht gelöst sind: interne, oft bewaffnet ausgetragene Auseinandersetzungen zwischen Zentralisten und Föderalisten, zwischen katholischen Konservativen und laizistischen Liberalen, zwischen der Oligarchie und Sozialrevolutionären.
Erst in der jüngsten Zeit nehmen jene Ideen, die vor 200 Jahren nur unvollendet oder gar nicht umgesetzt wurden, wieder Gestalt an: die Idee der politischen und wirtschaftlichen Einheit, die Integration aller sozialen und ethnischen Gruppierungen, die Rückgewinnung einer echten Souveränität und Unabhängigkeit.
Stefan Rinke gelingt es, ein tiefgründiges präzises Bild jener Zeit um 1800 in Lateinamerika und der Karibik zu zeichnen, jener bewegten Jahrzehnte, in denen, so Rinke, "die politischen Revolutionen zwar das Ende des Kolonialstatus brachten, doch die Unabhängigkeit mit neuen Abhängigkeiten begann."
Service
Stefan Rinke, "Revolutionen in Lateinamerika. Wege in die Unabhängigkeit 1760 - 1830", C. H. Beck
C. H. Beck