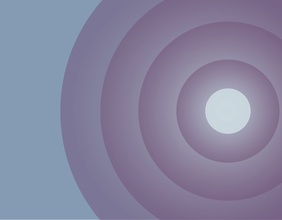Ehre, Stolz und Vorurteile
Von Cholos und Prolos
Mario Vargas Llosa nennt die Geringschätzung, mit der die Peruaner unterschiedlicher Schichten einander begegnen, die nationale Krankheit schlechthin. Er hat als Kind darunter gelitten: Sein Vater hatte aus Dünkel seine schwangere Ehefrau verlassen.
8. April 2017, 21:58
Ernesto Vargas, der Vater des Literaturnobelpreisträgers, war ein schöner Mann, der von Minderwertigkeitskomplexen geschlagen war. Weil seine Familie sehr arm war, gehörte er trotz seiner hellen Augen und seiner weißen Hautfarbe zum "Volk", zu den Cholos. Zumindest empfand er das so. Und das genügte ihm, seine junge hübsche Ehefrau aus gutem Hause erst wie das letzte Dienstmädchen zu behandeln, ihr jede auch noch so geringe persönliche Freiheit zu nehmen und sie quasi unter Daueraufsicht zu stellen, und sie letztendlich zu verlassen.
Er schickte die im fünften Monat Schwangere zu ihrer Mutter, damit sie das gemeinsame Kind dort zur Welt brächte, und tauchte unter. Dass er damit seine Frau der gesellschaftlichen Ächtung preisgab, interessierte ihn nicht. Mario Vargas Llosa wuchs vaterlos auf, aber im Schutz der Familie seiner Mutter. Bis sein Vater elf Jahre später wieder in sein Leben trat.
Strikte Klassenordnung
Die soziale Rangordnung, die sich in den ehemals spanischen Kolonien durchgesetzt hat, war seit den ersten Jahren der Eroberung sehr strikt: An der Spitze der Gesellschaft rangierten die Spanier selbst beziehungsweise ihre Nachkommen. Sie hatten den größten Grundbesitz, die beste Bildung, die reinste Sprache, die hellste Haut und die strengste Moral. Sie galten als adelig.
An der untersten Stelle der Hierarchie standen die Indios, die Eingeborenen, die Heiden, die Unzivilisierten, die Habenichtse, die von Gott zu Sklavendiensten erschaffen wurden. An die man keinen barmherzigen Gedanken zu verschwenden brauchte, weil sie durch ihre dunkle Haut schon als unrein gebrandmarkt waren. Und dazwischen waren die Cholos. Die Mischlinge. Die Mestizen. Die sozial Gescheiterten und daher Ehrlosen, Dummen, Armen. Cholo bedeutete zu Beginn des 17. Jahrhunderts "Hund", "kläffender Köter" oder sogar "schurkischer Kläffer".
Vorurteile von allen Seiten
"Es ist ein schwerer Irrtum zu glauben", schreibt Vargas Llosa in seiner Autobiografie "Der Fisch im Wasser", "Rassenvorurteile oder soziale Vorurteile gäbe es nur von oben nach unten; parallel zur Verachtung, die der Weiße gegenüber dem Cholo, dem Indio und dem Schwarzen an den Tag legt, existiert das Ressentiment des Cholo gegenüber dem Weißen und dem Indio und dem Schwarzen und das eines jeden der drei Letztgenannten gegenüber allen anderen: Gefühle, Triebe und Leidenschaften, die sich hinter den politischen, ideologischen , beruflichen, kulturellen und persönlichen Rivalitäten verbergen, eine Haltung, die man nicht einmal heuchlerisch nennen kann, da sie selten klar und unverhüllt ist."
Im Fall seiner Familie vernichtete der "Pesthauch jener nationalen Krankheit" das Glück einer jungen Familie - ohne konkreten Hintergrund, denn die vermeintliche Besserstellung der Familie seiner Frau existierte nur in der Vorstellung des Vaters und Ehemannes.
Erwachendes Selbstbewusstsein
Diese Plage der gegenseitigen Geringschätzung gibt es nicht nur in Peru. Sie ist Thema unzähliger literarisch verarbeiteter Tragödien. Und sie wird in den letzten Jahren prominent unterlaufen: Alejandro Toledo, peruanischer Staatspräsident von 2001 bis 2006, ließ sich von seinen Anhängern "Cholo" nennen. Das Cholo-Sein wird in Liedern und TV-Shows thematisiert, und das vermehrte Auftreten von Cholos im Fernsehen ließ den Begriff "El Chollywood Peruano" entstehen. Man könnte sich beinahe an das Salonfähig-werden des Wiener Prolos wie Ostbahn-Kurti oder Karl Merkatz alias Edmund Sackbauer erinnert fühlen...
Service
Mario Vargas Llosa, "Der Fisch im Wasser. Erinnerungen", Suhrkamp