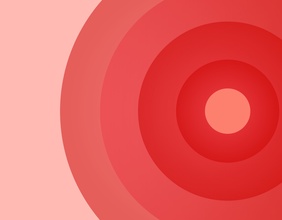Die Lebensgefährtin, das unbekannte Wesen
Hubert Winter über Birgit Jürgenssen
Hubert Winter ist der Nachlassverwalter und einstige Lebenspartner der 2003 verstorbenen Künstlerin Birgit Jürgenssen. Dass eine Begegnung mit einem Menschen, mit dem man jahrzehntelang zusammen lebte, sich nach dessen Tod noch weiterentwickeln und sogar vertiefen kann, klingt nur scheinbar paradox.
8. April 2017, 21:58
"Ich bin draufgekommen - und ich komme erschreckenderweise täglich mehr drauf - dass ich viele Seiten an der Birgit nicht gekannt habe, und dass sich mir derzeit ein Mensch darstellt, den ich vielleicht so gar nicht gekannt habe. Es ist eine ‚Begegnung in progress‘, die mir, solange ich lebe, positiv und negativ zu schaffen machen wird", sagt Winter über seine Beziehung zu Jürgenssen.
Einsatz für andere
Jürgenssen, der derzeit eine umfangreiche posthume Ausstellung im Wiener Bank Austria Kunstforum gewidmet ist, war eine manische Arbeiterin und hinterließ tausende Negative, an die 800 Zeichnungen und unzählige experimentelle Objekte, die selbst für den Gefährten noch Unbekanntes offenbaren. Erst jetzt, sieben Jahre nach dem Tod der mit 53 Jahren an Krebs Verstorbenen, fällt auch das Licht einer breiteren Öffentlichkeit auf Jürgenssens Werk - und auf ihre Persönlichkeit. Es offenbart das Bild einer Künstlerin, die zeitlebens im Schatten des Kunstbetriebs werkte:
"Da gab es diese absurde Episode, dass der Harald Szeemann, der für seine Biennale Künstler gesucht hat, zu Birgit ins Atelier kommen wollte, und die Birgit hat gesagt, schau dir lieber die Arbeiten der Studentinnen an der Akademie an! - Die berühmten Kuratoren haben ja nur zwei Stunden Zeit, dann müssen sie schon wieder nach Peking oder sonst wohin fliegen - und Anna Jermolaewa wurde auf die Biennale genommen. Das war die Birgit!
Übergangene Frauen
Birgit Jürgenssen hatte an der Wiener Akademie der Bildenden Künste Lehraufträge in den Meisterklassen von Maria Lassnig und Arnulf Rainer inne, ihre Weggefährten waren namhafte Künstler wie Peter Weibel oder Walter Pichler; weibliche Namen wurden Ende der Sechzigerjahre indes - mit wenigen Ausnahmen - eher als Staffage denn als eigenständige Schöpferinnen wahrgenommen:
„Es gibt ja unglaublich viele Beispiele: Maria Lassnig etwa, die als fast 70-Jährige als Professorin noch für ein paar Jahre an die Hochschule geholt wurde, damit sie eine Pension kriegt, wie spät die gesehen wurde! Louise Bourgois, Meret Oppenheim, Agnes Martin, die Witwe von Jackson Pollock, die als Künstlerin überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Dieser Blutzoll, den die Frauen in der Kunst geleistet haben! Es ist unglaublich, dass sich eine Gesellschaft diesen Abfluss an Kreativität leisten kann, das wird ja jetzt erst, in den letzten zehn Jahren, korrigiert.“
Missing link
Peter Weibel bezeichnete Birgit Jürgenssen als „missing link“ zwischen Maria Lassnig und Valie Export. Jürgenssen inszenierte sich gleichsam selbst zum Kunstwerk, indem sie als ihr eigenes Modell arbeitete; ihre feministische Betrachtungsweise unterschied sich jedoch von jener der meisten ihrer Kolleginnen in den späten Sechziger Jahren durch einen subversiven Charakter und einen ironischen Blick. So spielte sie mit Vorliebe mit den klischeehaften Vorstellungen von Weiblichkeit, verwendete etwa reichlich Lippenstift und trug auffallend elegante Kleidung - sowie mit Vorliebe exquisite Schuhe:
„Es ging ihr natürlich um den Fetischcharakter: bis zu den Handschuhen herauf ist da ja alles fetischisiert. Aber sie wollte immer den männlichen Blick, den Fetischblick brechen, indem sie die Verführerin war. Sie wurde nicht verführt, sie sie wollte verführen! Und das ist sozusagen die Umkehrung dieses Blicks des Fetischisten.“
Vorliebe für das Neue
Für die Ausstellung musste das von Jürgenssen hinterlassene Schuhwerk erst restauriert werden, mottenzerfressen war etwa der „Federschuh“, zerfallen der „Rostschuh“ und bereits Stückwerk der „Brotschuh“, den Jürgenssen aus Leder, Speck und Brotkrumen fabriziert hatte. Und was die unzähligen Zeichnungen betrifft, so waren diese teilweise achtlos zusammengerollt und in verstaubten Winkeln liegen gelassen, da Jürgenssen die Angewohnheit hatte, für Ausstellungen ausschließlich neue Exponate zu verwenden, bereits fertige Objekte ließ sie eher achtlos herumliegen. Der Wert jener „herumliegenden“ Exponate wird den Experten erst jetzt bewusst:
"Die Birgit war eine exzellente Zeichnerin, sie hat in den 70erJahren ein zeichnerisches Werk geschaffen, das damals überhaupt keinen Wert hatte. Die künstlerische Situation am Ende der 60er-Jahre war so, dass der gesamte ästhetische Markt durch die unglaubliche Präsenz der Wiener Schule - Hausner, Brauer, Hutter usw. - dominiert wurde. Und man konnte nicht differenzieren, man hat diese Zeichnungen vielleicht sogar als ein Anhängsel oder als Spätausläufer der Wiener Schule gesehen. Diesen untergründigen, subversiven Witz, diese feministische Haltung hat man überhaupt nicht gesehen, auch nicht1975, als die Birgit mit dem Objekt ‚Küchenschürze‘ kam, diese Zeichnungen sind ja fantastisch, davon kann sich jeder in der Ausstellung im Kunstforum überzeugen.“
Späte Genugtuung – aber für wen?
Mit großer Befriedigung sieht Hubert Winter, wie Jürgenssens Werk seit kurzem auch international anerkannt wird; die Trauer über den Tod der Lebensgefährtin kann dadurch nicht gemindert werden. Die 2001 diagnostizierte Krebserkrankung sieht Hubert Winter als die Katastrophe seines eigenen Lebens:
„Das Sterben war in unserem Leben ausgeklammert, wir waren ja vollkommen lebendig. Wir sind jeden Samstag und Sonntag auf die Rax Schifahren gegangen und haben Schitouren gemacht, es war ein Vergnügen, ihr dabei zuzuschauen, hinter ihr herzufahren, sie war ein Lehrbeispiel der österreichischen Skischule! Und sie hat eine Gesundenuntersuchung gemacht, und nach der Gesundenuntersuchung, am Nachmittag des 11.September 2001, als die Zwillingstürme gefallen sind, hat sie mich angerufen und hat gesagt, Hubert, ich muss, glaub ich, dringend ins Spital, weil die Ärztin ist sich nicht ganz sicher...Und dann sind wir ins Spital, ins AKH, und dann haben sie gesagt: ‚Sie müssen operiert werden, gleich, planen Sie nichts mehr, keinen Urlaub. Und dann begann diese Leidenszeit. Irgendwann sind mir die Tränen runter geronnen, und sie hat gesagt: ‚Hubi, wein nicht‘. Solche Situationen gab es.
Diese posthumen Karrieren sind das traurigste, was man überhaupt erleben kann, das alles hat einen Trauerflor für mich. Das Leben kann man ja nicht zurückholen, das Leben ist gelebt. Natürlich ist es eine Genugtuung, wenn man sich am Nachruhm erfreuen kann, Genugtuung – aber für wen?“