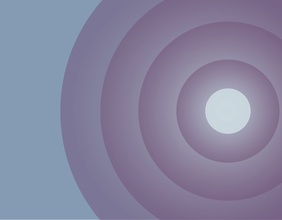Was man schon alles hätte wissen können
Musikort Kloster
Redliche Wissenschaft bemüht sich stetig um den Bezug zu den für sie relevanten Quellen. Das bedeutet genauso stetig den Schutt gesellschaftlicher Gegebenheiten wegzuräumen - um darunter Kontinuitäten zu entdecken. Die Fragestellungen des Sammelbandes "Musikort Kloster - Kulturelles Handeln von Frauen in der frühen Neuzeit" bestätigt diese Aussage auf vielfältige Weise.
8. April 2017, 21:58
Zitat
Bereits die Benediktusregel schrieb den abendländischen Mönchen und Nonnen das regelmäßige Chorgebet und damit mehrere Stunden täglichen Singens vor.
Ja eben. Mönchen und Nonnen. Und man erinnert sich an die mittelalterlichen Doppelklöster und das Phänomen des antiphonalen Gesanges - Männer und Frauen, an den Seitenwänden der Klosterkirche einander gegenübersitzend erfüllten so das Gotteshaus mit stereophonen Klängen. Und natürlich sind neben den cantores auch die cantarices respektive magistrae - mittelhochdeutsch "Sangmeisterinnen" - bekannt und es könnten einem da Namen wie Hildegard von Bingen oder Mechthild von Magdeburg im hohen Mittelalter einfallen.
Was das Buch also leistet ist nicht "Neues" an den Tag zu fördern, sondern eigentlich ohnehin immer schon Bekanntes - oder vielleicht besser gesagt: bekannt sein Könnendes - nichts weniger als eben wieder bekannt zu machen, so skurril das auch klingen mag.
Ja eben. Mönchen und Nonnen. Und man erinnert sich an die mittelalterlichen Doppelklöster und das Phänomen des antiphonalen Gesanges - Männer und Frauen, an den Seitenwänden der Klosterkirche einander gegenübersitzend erfüllten so das Gotteshaus mit stereophonen Klängen. Und natürlich sind neben den cantores auch die cantarices respektive magistrae - mittelhochdeutsch "Sangmeisterinnen" - bekannt und es könnten einem da Namen wie Hildegard von Bingen oder Mechthild von Magdeburg im hohen Mittelalter einfallen.
Was das Buch also leistet ist nicht "Neues" an den Tag zu fördern, sondern eigentlich ohnehin immer schon Bekanntes - oder vielleicht besser gesagt: bekannt sein Könnendes - nichts weniger als eben wieder bekannt zu machen, so skurril das auch klingen mag.
Dem dienen Feststellungen wie diese:
Zitat
Nicht nur Choralgesang und geistliche Lieder prägten den Alltag und Festtag der Nonnen, auch weltliche Lieder hatten einen festen Platz innerhalb des Gemeinschaftslebens, auch wenn die strenge Reform diese Tradition unablässig zurückzudrängen suchte. Der weltliche Gesang hatte ebenso wie der geistliche eine wichtige gemeinschaftsbildende Funktion, die in diesem Fall nicht nur die Chornonnen oder Kleriker, sondern die ganze Klosterfamilia umfasste.
Klosterfamilia: alle, die irgendwie dazugehören zum Konvent, ob mit Gelübden oder ohne dieselben - von der Äbtissin oder dem Propst bis hin zu den Knechten im Stall oder den Mägden in der Waschküche. Das "Kloster" als multifunktionale Einrichtung war für sie alle auch ein Ort der Musik - der zu hörenden und der selbst zu singenden. Und dies zu allen sich bietenden geistlichen und weltlichen Gelegenheiten, wobei der mittelalterliche Mensch da sowieso weniger Unterschiede machte als wir Heutigen.
Durchaus aufschlussreich ist die in diesem Buch vorgenommene Gegenüberstellung der Situationen in weiblichen protestantischen Gemeinschaften der Frühzeit der Reformation mit jener in katholischen Frauenklöstern des italienischen Frühbarock. Beide können unter dem gemeinsamen Aspekt der Urbanität betrachtet werden. Städtische kulturelle Phänomene machten auch vor Klostermauern nicht halt. Aber vielleicht waren dieselben garnicht so dicht? Diese Frage stellt sich angesichts der einstmaligen Popularität von Musik italienischer Nonnen auch außerhalb der Geschlossenheit von deren Klöstern.
Zitat
Die Frage der Öffentlichkeit bzw. Nichtöffentlichkeit klösterlicher Musikpraxis gehört zu den besonders spannenden Fragen musikhistoriographischer Rekonstruktion, denn die vom Tridentiner Konzil 1563 erlassene Vorschrift der clausura verleitet zur Annahme, durch diese Regelung sei die Nichtöffentlichkeit besiegelt worden. Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass sich solch ein reiches Musikleben in den italienischen Klöstern hat entfalten können und man fragt sich: woher bekamen die Nonnen Anregungen, unterrichteten sie sich gegenseitig oder kamen doch Lehrer ins Kloster?
Spannend ist nicht nur die Frage, sondern auch deren eigene Rekonstruktion.
Und wenn auch Klosterkomponistinnen wie Chiara Margarita Cozzolani, Isabella Leonarda oder Maria Xaveria Perucona mit ihrem umfangreichen Kammermusikwerk kaum mehr ins Musikleben zurückkehren werden - die Zeit ging über ihre Kunst hinweg wie über jene ihrer männlichen Zeitgenossen - so lässt die wiederentdeckte Popularität dieser Namen, die ja mit dem Werk eng verknüpft ist keinen Zweifel darüber offen, dass erstens die Klöster eminente Orte jeglicher Musik waren und dass dort auch die weibliche Kreativität gefordert und wirksam war.