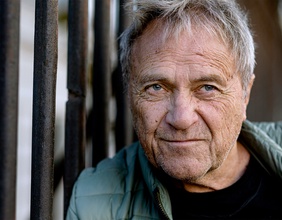Finanzierung aus Drittmitteln
Forschung Sache privater Financiers?
Laut der Forschungs- und Innovationsstrategie der Bundesregierung soll sich die heimische Forschung künftig zu 70 Prozent aus sogenannten Drittmitteln finanzieren, also aus Geldern der Privatwirtschaft. Ist das umsetzbar und wünschenswert?
8. April 2017, 21:58
Eine Umwälzung der Verhältnisse
Rund zwei Drittel der Forschung, vor allem der angewandten, aus der Privatwirtschaft finanziert: das wäre gelinde gesagt eine Umwälzung der Verhältnisse in Österreich, dem Land der Klein- und Mittelbetriebe.
Sogar die Grundlagenforschung soll mehr Geld aus der Wirtschaft anwerben, meint Wissenschaftsministerin Beatrix Karl. Das heißt nicht, dass sich der Staat zurückziehen soll, sagt sie, aber: "Internationale Studien belegen, dass wir in Österreich ein sehr hohes Maß an öffentlicher Finanzierung an den Hochschulen haben und dass wir stärker auf private Beteiligung setzten müssen, um unsere Hochschulen zukunftsfit zu machen und für den internationalen Wettbewerb besser zu rüsten."
Kein ungefährlicher Weg
Was dabei zu vermeiden ist weiß der Rektor der Technischen Universität Wien Peter Skalicky. Seine Hohe Schule wirbt pro Jahr 71 Millionen Euro an Drittmitteln ein - eine hohe Summe, jedoch: "Es ist keine gute Idee Forschung so zu finanzieren, indem man sagt: 'Schaut her, hier gibt es Geld. Was fällt euch jetzt dazu ein?'. Dann fällt allen möglichen Leuten irgendetwas ein, um an das Geld zu kommen. Das ist aber falsch. Es ist umgekehrt, es sollte Nachfrage orientiert sein. Hier gibt es ein Problem. Was fällt euch dazu ein? Wir sorgen für die Finanzierung."
Ist die Grundlagenforschung gefährdet?
Aber verändern private Geldgeber nicht automatisch die Ausrichtung und den Alltag von Forschung? Auch die Wirtschaftsuniversität Wien kooperiert ihrer Natur entsprechend viel mit der Privatwirtschaft.
Ihr Rektor Christoph Badelt ist allerdings sehr vorsichtig, denn er fürchtet um den Fortbestand der aus wissenschaftlicher Neugier betriebenen Grundlagenforschung.
"Ich finde es legitim, wenn Unternehmen mit Universitäten Partnerschaften eingehen. Das macht auch die WU, um eben im Sinne der Auftragsforschung interessante, anwendungsbezogene Themen zu erforschen und Produkte auf den Markt zu bringen, Prozesse auf den Markt zu bringen, das ist alles gut und wichtig und soll ausgebaut werden, aber ich sehe die Gefahr, dass man sich zu sehr auf diese Art der Forschung verlässt. Und die Forschung, die langfristig das allermeiste bringt, ins Hintertreffen gerät", sagt Badelt.
Denn die superreichen Mäzene, die ohne Ansprüche zu stellen aus reinem Spleen Forschung finanzieren gibt es kaum - zumindest nicht in Österreich.