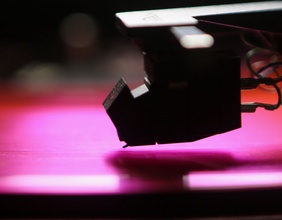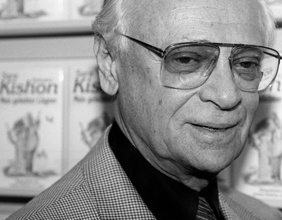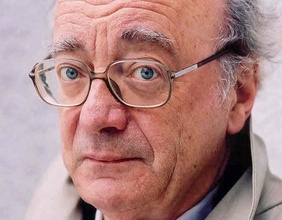Neue Rolle in Libyen und Elfenbeinküste
Die UNO als Weltpolizist
Die UNO hat in den letzten Wochen zwei auffällige Signale gesetzt: In Libyen hat sie ein militärisches Eingreifen zum Schutz der Zivilbevölkerung gutgeheißen. Und in der Elfenbeinküste hat die UNO sogar selbst militärisch die Initiative ergriffen. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Vereinten Nationen, der einige Fragen aufwirft.
23. November 2023, 15:32
Mittagsjournal, 06.04.2011
Paradigmenwechsel fand statt
Die "responsibility to protect", die Verantwortung jedes Staates, seine Bevölkerung zu schützen, steckt in beiden Fällen hinter dem Handeln der UNO. Diese Schutzverantwortung wurde schon 2005 beschlossen, hat bis jetzt aber selbst in bewaffneten Konflikten keine Rolle gespielt. Sie legt fest, dass jeder Staat die Verpflichtung hat, schwerste Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Kann oder will er das nicht, geht die Verpflichtung auf die internationale Gemeinschaft über, der als letzte Möglichkeit auch militärisches Eingreifen - wie in Libyen oder der Elfenbeinküste - offensteht. Ein Paradigmenwechsel, hat man sich doch bisher eher an die Maxime der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates gehalten.
"Zivilisierung der internationalen Politik"
Othmar Höll vom österreichischen Institut für Internationale Politik sieht die UNO auf einem guten Weg und spricht von einem "sehr wichtigen Schritt in Richtung einer stärkeren Zivilisierung der internationalen Politik". Er geht aber nicht davon aus, dass sich auch in Zukunft alle fünf Veto-Mächte über Interventionen einig sein werden.
"Augenmaß behalten"
Der Menschenrechtsexperte Manfred Novak weist darauf hin, dass ein solches Eingreifen auch Augenmaß verlangt, um künftig glaubwürdig zu bleiben. Andernfalls würden dann wieder die Skeptiker, primär China und Russland, sagen, sie hätten es ja gewusst und würden sich das nächste Mal nicht mehr der Stimme enthalten, sondern wieder ein Veto einlegen. "Dann ist diese Möglichkeit wieder für einige Jahre vertan."
Ein Gradmesser für ein militärisches Eingreifen in einem Staat wird vermutlich die Frage sein, ob man dadurch größeres Blutvergießen verhindern kann. Klar ist aber auch, dass selbst die Schutzverantwortung als rechtliches Instrument die internationalen Spielregeln nicht dramatisch verändert. Da sind sich Manfred Novak und Othmar Höll einig.
Kein Kampf gegen die Mächtigen
Höll: "Die Charta der Vereinten Nationen mit dem Völkerrecht ist so angelegt, dass ein Vorgehen gegen einen wirklich großen und mächtigen Staat immer ausgeschlossen bleibt, weil das im Grundgenommen zu einem Flächenbrand oder einem Weltkrieg führen könnte. Ich glaube, dass das sehr weise gewesen ist von den Gründungsvätern der Vereinten Nationen und dass dieses Prinzip auch in der Zukunft Bestand hat."
Sonst "Dritter Weltkrieg"
Nowak: "Gegen sehr mächtige Staaten hat es wenig Sinn, etwa zu sagen, wir schützen die Zivilbevölkerung in Tibet auch mit militärischer Gewalt. Dann haben wir einen Dritten Weltkrieg. Das kann es nicht sein."
Diktatoren unter Druck
Verändern wird sich dagegen der Druck, der zum Beispiel auf Diktatoren ausgeübt werden kann. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberungen und Völkermord können sie schon jetzt vor den internationalen Strafgerichtshof bringen. Das mögliche militärische Eingreifen sollte eine zusätzliche abschreckende und präventive Wirkung gegen systematische Menschenrechtsverletzer haben, hofft Menschenrechtsexperte Novak.
Keine Dauereinrichtung
Gänzlich verhindern wird aber auch die Schutzverantwortung solche Verbrechen nicht, sagt Othmar Höll. "Wie die Geschichte der Menschheit und der internationalen Politik zeigt, werden wirklich kriminelle Regime auch durch dieses Vorgehen nicht abgehalten werden."
Der Normalfall kann und wird ein UNO-legitimiertes Eingreifen aber nicht werden. Dazu bedarf es, wie der Einzelfall Libyen zeigt, viel diplomatischen Geschicks, um die Vetomächte davon abzuhalten, von ihrem Recht Gebrauch zu machen.
Service
Österreichisches Institut für internationale Politik
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte