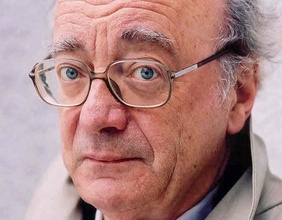Posthum erstellter Roman von Thomas Wolfe
Die Party bei den Jacks
Niemals in der jüngeren Geschichte ging es mit der amerikanischen Wirtschaft so schnell bergab wie in den 1930er Jahren. Nach dem schwarzen Donnerstag - dem historischen Börsencrash vom 24. Oktober 1929 - begann die Große Depression.
8. April 2017, 21:58
Die Arbeitslosenzahl stieg auf mehr als 25 Prozent. Die Durchschnittslöhne fielen um 60 Prozent. Innerhalb von drei, vier Jahren, verarmten große Teile der Bevölkerung. So ausschweifend, so lebensbejahend, so frivol die 1920er Jahre gewesen waren, so dunkel, so depressiv, so prüde waren die 30er Jahren.
Das spiegelte sich natürlich auch in der Kultur wider. Nun hießen die Songs nicht mehr "Yes, We Have No Bananas", sondern "Talking Dust Bowl Blues". Und in den Romanen ging es nicht mehr darum, wie sich junge, schlanke Frauen mit Bubikopf am besten langweilen können, sondern darum, wie Mütter darum kämpfen müssen, ihre Kinder vor dem Verhungern zu retten.
Das alles muss man im Hinterkopf behalten, wenn man ein Buch wie "Die Party bei den Jacks" liest, denn an diesem Roman, der erst 1995 posthum aus verschiedensten Manuskripten zusammengestellt wurde, begann Wolfe erst nach dem Börsencrash zu schreiben. Wenn er also über die glamouröse Party, die am 2. Mai 1928 in New York stattfindet und bei der sich, wie es heißt, "die Besten, Vornehmsten und Schönsten, die diese Stadt zu bieten" hat versammeln, dann ist diese Feier nichts anderes als ein symbolischer Abgesang auf die Goldenen Zwanziger Jahre.
Die oben und die unten
Wolfe beschreibt in diesem 300 Seiten starken Buch nur einen einzigen Tag. Er berichtet, wie sich die beiden Gastgeber, Herr und Frau Jack, auf die Party vorbereiten, er schreibt darüber, wie die Gäste eintrudeln, wie das Personal behandelt wird und worüber die Besucher so reden.
Da ist zum Beispiel Lily Mandell, Erbin eines Midas-Vermögens, wie es heißt. Ihr Vater war Besitzer eines "Handelsimperiums mit Schätzen, die im Schweiß von Massen namenloser Sklaven angehäuft worden waren." Sie selbst ist eine "sinnliche Schönheit, die noch nie die Billigabteilungen in einem Kaufhaus mit ihrem Besuch beehrt hatte".
Wolfes Sympathien gehören den anderen; den Angestellten, den Fahrstuhlführern, den Taxifahrern, den Dienstboten. Sie sind es auch, die in diesem Roman überall schon die Vorboten des Unterganges wahrnehmen, während der Börsenspekulant Frederick Jack mit kindlicher Naivität an die schillernde Blase der Spekulation glaubt. Manchmal, wenn er wieder auf New York blickt, diese Stadt, dessen grandiose Architektur ihn immer wieder aufs Neue mit Glück erfüllt, wird er kurz von Zweifel geplagt. Aber schnell beruhigt er sich und ist überzeugt, dass alles schon wie bisher weitergehen werde.
Die alte Ordnung
Diese Gegenüberstellung ist nicht nur historisch unkorrekt, denn die Blase von 1929 entstand ja genau deswegen, weil auf einmal auch Dienstmädchen, Taxifahrer und Aufzugsführer Aktien kauften in der Überzeugung, es müsse immer weiter bergauf gehen, es ist auch ein wenig plump. Überhaupt ist das ein Manko dieses Textes: Alles ist Metapher.
Eine zentrale Funktion haben bei dem Buch die Aufzugsführer, denn sie verbinden das Oben mit dem Unten, also die Reichen mit den Armen. Dann, quasi als Höhepunkt des Romans, bricht auf der Party ein Feuer aus. Die Gäste müssen das Gebäude verlassen, stehen auf der Straße und werden dort für einen kurzen Moment mit Dienstboten und Angestellten eins. Aber kaum ist das Feuer gelöscht, geht das Fest weiter und die alte Ordnung ist wiederhergestellt. Zumindest für ein Jahr. Bis sie dann komplett zusammenbrechen wird.
Teils großer Stilist, teils redundant
Liest man dieses Buch und vergleicht man es mit Werken, die zur gleichen Zeit entstanden sind - mit jenen von F. Scott Fitzgerald zum Beispiel oder auch jenen von Ernest Hemingway oder John Dos Passos - dann wirkt es seltsam antiquiert. Thomas Wolfe wurde 1900 geboren. Er war also vier Jahre jünger als Fitzgerald und Dos Passos und ein Jahr jünger als Hemingway. Es gäbe, schrieb Wolfe einmal an Fitzgerald, zwei Arten von Autoren: die "leaver-outers" und die "putter-inners", also jene, die so viel wie möglich wegließen, und jene die so viel wie möglich in jeden Satz hineinpacken. Vor allem Hemingway war so ein Meister des Weglassens. Wolfe hingegen versuchte, so viele Adjektive wie möglich in einen Satz zu packen und jede Handlung seiner Protagonisten bis ins kleinste Detail nachzuzeichnen.
Mitunter ist Wolfe ein grandioser Stilist und ein fabelhafter Erzähler. Wenn er erzählt, wie sich die Reichen daran erfreuen, dass sie von ihren Untergebenen bestohlen werden, wenn er über drei Seiten den Chauffeur von Frederick Jack beschreibt und ihn mit seinem Fieber und seiner Hektik mit New York gleichsetzt, dann sind das Passagen, wie man sie besser nicht schreiben könnte. Gleich darauf aber wird über 13 Seiten hinweg penibel genau das Morgenritual von Fredrick Jack geschildert. Wo andere Autoren seiner Zeit ein Wort oder einen ganzen Satz wegließen, da sattelt Wolfe noch mindestens drei Adjektive drauf. "Manieriert und redundant" nennen das Kritiker heute. Das mag etwas streng sein, aber dass der früh verstorbene Wolfe "einer der wichtigsten amerikanischen Autoren der ersten Jahrhunderthälfte" ist, wie es nach seinem Tod 1938 hieß, dafür ist "Die Party bei den Jacks" kein Beweis.
service
Thomas Wolfe, "Die Party bei den Jacks", aus dem Amerikanischen übersetzt von Susanne Höbel, Manesse Verlag
Manesse - Die Party bei den Jacks