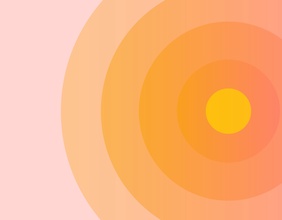Der globale Siegeszug der Casting-Shows
Die Diktatur der Angepassten
In den letzten Jahren sind Castingformate geradezu wie Pilze aus dem Boden geschossen. Private aber auch öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten entwickeln unablässig neue Talent- und Leistungsshows, die letztlich immer nach demselben Prinzip funktionieren. Was macht den Reiz der Casting-Shows aus? Und: Sagt das Casting-Prinzip etwas über die Befindlichkeit unserer Gesellschaft aus?
8. April 2017, 21:58
In einem Wiener Einkaufszentrum herrscht reger Betrieb. An die 100 Mädchensind gekommen, um sich für die neue Topmodel-Staffel zu bewerben, die der österreichische Ableger eines deutschen Medienkonzerns ab Jänner ausstrahlen wird. Hier wird nichts dem Zufall überlassen: Mit der unverbindlichen Freundlichkeit, die Fernsehmenschen gerne an den Tag legen, dirigiert ein zehnköpfiges Produktionsteam die recht unbeholfen wirkenden Bewerberinnen. Die meisten haben sich in Schale geworfen und sehen so aus, als würden sie auf den ganz großen Auftritt in einer Dorfdisco warten: wasserstoffblondes Haar, Extensions, die zu Korkenzieherlocken gedreht sind, knappe Minis und hochhakige Schuhe, in denen sie nicht eben grazil staksen. Models in Paris, oder Mailand sehen anders aus.
Österreich hat einen wahren Casting-Sommer hinter sich. Im August ging Deutschlands Sprücheklopfer Nummer 1, Dieter Bohlen, im Wiener Volkstheater auf Talentsuche. Kurz davor hatte es sein Pendant vom Konkurrenzformat "Popstar", Detlev D! Soost, auf Österreichs Talente abgesehen. Zeitgleich bemühte sich auch der ORF, Brosamen vom großen Casting-Kuchen einzusammeln und castete Talente für die neue Hauptabend-Unterhaltungsshow "Die große Chance".
Das Casting-Karussell dreht sich weiter
Nach über zehn Jahren im deutschsprachigen Fernsehen dreht sich das Casting-Karussell munter weiter. Abnützungserscheinungen wie beim Reality-Format "Big Brother" zeichnen sich nicht ab. Ganz im Gegenteil: Unablässig brüten die Programmentwickler der großen Fernsehanstalten über neuen Formaten. Neben den Klassikern "Popstars", "Deutschland sucht den Superstar" und "Germany's Next Topmodel", kämpfen Sendungen wie "X-Faktor", "Die große Chance" oder "Das Supertalent" um Marktanteile bei der viel zitierten werberelevanten Zielgruppe. Und der Erfolg gibt ihnen recht: Weder laufen den nicht eben originellen Talentshows die Zuschauer davon noch scheint der Strom hoffnungsvoller Kandidaten je zu verebben.
Mitunter kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ganze Sender einzig und allein aus der Suche nach neuen Stars bestehen. Die Starmaschine ist warmgelaufen, die Massenmedien sorgen für den nötigen Multiplikator – an formbarem Menschenmaterial mangelt es nicht. Es wird gebraucht in den Medien neuen Zuschnitts, wie Georg Franck von der TU Wien sagt:
"Wenn man Medien nicht als technische Anlagen sieht, sondern als Informationsmärkte, dann sind die alten Medien jene, die Information gegen Geld verkaufen wie Presse, Bücher, oder Kino, und die neuen Medien sind jene, die dem Publikum die Informationen nachwerfen, nur um an die Aufmerksamkeit ranzukommen. Sie finanzieren sich, indem sie diese Attraktionsleistung an die Werbewirtschaft verkaufen", so Georg Franck, selbst ein Star im Wissenschaftsbetrieb, seit er mit dem Begriff "Aufmerksamkeitsökonomie" das Schlagwort der Stunde geliefert hat.
"Die massenwirksame Kultur ist eine werbefinanzierte Kultur. Wenn man die Attraktion von Aufmerksamkeit als Massengeschäft betreiben will, dann braucht man Promis in Massen und die werden in diesen neuen Medien auch herausgebracht und als Zugpferde eingesetzt. Man kann ja heute schon von einer regelrechten Fließbandproduktion von Promis sprechen."
Gib alles, was du hast!
Es wird also weiter gecastet. Dabei weiß mittlerweile im Grunde jeder, dass die einzigen Stars dieser Unterhaltungsshows die Juroren selbst sind. Allen voran Dieter Bohlen, der das Image vom Supermacho mit gewöhnungsbedürftiger 80er-Jahre-Fönfrisur abgelegt und von einer Pointe zur nächsten die Herzen der Zuschauer erobert hat. Sicher rhetorisch geschliffen, ist das, was Bohlen im Laufe einer Sendung so von sich gibt, nicht unbedingt, seine scharfzüngigen Kommentare wirken aber jedenfalls um einiges spontaner als die offensichtlich auswendig gelernten Zeilen, die Kollegin Heidi Klum dem Fernsehpublikum zumutet.
Der Dritte im Bunde, Detlev D! Soost, Juror der Sendung "Popstars", hat sich mit dem martialischen Auftreten eines amerikanischen Bootcamp-Coachs einen fixen Platz im Casting-Himmel erobert. Er hat für Momente im deutschen Fernsehen gesorgt, die man noch vor nicht allzu langer Zeit für unmöglich gehalten hätte. Dank D! gehören sadistisch anmutende Sporteinheiten, in denen Jugendliche vor laufender Kamera bis zur Erschöpfung gequält werden, zur fixen Zutat der Casting-Shows. D! hat seinen Darwin wahrscheinlich nicht gelesen, den Satz, dass nur die Fittesten durchkommen, scheint er aber gut zu kennen.
Als perfekte Inkarnation der Wettbewerbsdoktrin bringt D! seine Botschaft in die Kinderzimmer der jugendlichen Zielgruppe. Eine Botschaft von rhetorischer Schlichtheit, die ihre Wirkung vor allem aufgrund gebetsmühlenartiger Wiederholungen entfaltet:
"Du musst an dich glauben! Du musst an dir arbeiten! Du musst abliefern! Du kannst es schaffen, wenn du alles gibst!"
Fleiß, Disziplin und Wettbewerb
Und: Das wird nicht explizit gesagt, aber implizit gemeint: Du kannst es schaffen, wenn du nicht widersprichst! Die Casting-Formate tischen ihrem jugendlichen Publikum eine zeitgeistige Neuauflage des protestantischen Arbeitsethos auf, gepaart mit dem Heilsversprechen einer individualisierten Gesellschaft: der Aussicht auf Selbstverwirklichung nämlich! Jeder kann vom "Nobody zum Superstar" werden, wenn er nur hart genug arbeitet - ein Lockruf, der nicht zufällig an die uramerikanische Erfolgserzählung "Vom Tellerwäscher zum Millionär" erinnert. Eine, die es am anderen Ende des Teiches geschafft hat, Heidi Klum, vermittelt jungen Mädchen nicht nur, dass sie sich auf ihre eigentlichen Qualitäten, nämlich ihr Aussehen, besinnen sollen (Pech für alle, die in der Genlotterie den Kürzeren gezogen haben!), Klum wird wie Kollege D! nicht müde, die dreifaltige Erfolgsformel von Fleiß, Disziplin und Wettbewerb zu predigen.
Wer zu verschwörungstheoretischen Gedankenexperimenten neigt, kommt nicht umhin, auf die Idee zu kommen, dass das alles vor allem darauf abzielt, eine ganze Generation für den Verdrängungswettbewerb am Arbeitsmarkt abzurichten. Und: Damit die bittere Pille besser schmeckt, serviert man sie vor der glamourösen Kulisse des Model-, oder Musikbusiness. Am Ende wartet dann nicht Gottes Lohn, sondern ein Platz im Starhimmel.
service
Georg Franck, "Ökonomie der Aufmerksamkeit", Hanser Verlag
diegrossechance.ORF.at
Übersicht
- Medien