Werkschau Terunobu Fujimori
Terunoba Fujimori ist hierzulande nur Insidern ein Begriff, in seiner Heimat Japan aber gilt er als Star der Architekturszene. Der weltweit einzige "surreale Architekt", wie manche ihn nennen, ist berühmt für seine verrückten, poetisch und zugleich archaisch wirkenden Entwürfe.
8. April 2017, 21:58
Häuser mit Böden aus gestampftem Lehm und Wänden aus verkohltem Zedernholz oder Dächern, auf denen Schnittlauch und Löwenzahn wachsen. Mit der Ausstellung "Terunobu Fujimori. Architekt" im Museum Villa Stuck in München ist nun zum ersten Mal in Deutschland eine große Werkschau des 65jährigen Japaners zu sehen.
Service
Die Ausstellung "Terunobu Fujimori. Architekt"
ist bis 16. September 2012 im Museum Villa Stuck in München zu sehen.
Museum Villa Stuck
Unverwechselbare Häuser
Seine Häuser sind unverwechselbar, bizarr und voller Charme, mit schiefen Winkeln, asymmetrischen Formen und skurril wirkenden Dächern. Terunobu Fujimoris Architektur ist der lebendige Gegenentwurf zum kühlen Rationalismus der Moderne, zu glatten Materialien und steifem Repräsentationsbedürfnis. Sein Thermalbad Lamune ist ein Bau mit markanten Türmen, aus denen Kiefern sprießen, und einer Außenhaut aus verkohlter Zeder und hellem Mörtel, die einem Zebramuster gleicht.
Sein "Fliegendes Lehmboot" von 2010, ein an Seilen aufgehängtes, kleines, kugelförmiges Gebilde mit Lehmbauch und Schuppendach, sieht aus wie ein lustiges Ufo. Sein Studentenwohnheim für die Präfektur Kumamoto erinnert von außen an eine europäische Klosteranlage und von innen mit seinen vielen großen Rotkieferstämmen an einen Wald.
Und sein Yoro-Insektenmuseum wirkt wie ein bulliges Biotop mit seinem Satteldach, auf dem Iris, Moosfarne und Tigerlilien, Ballonblumen und Schnittlauch wachsen. Fujimori reizt das Spiel von Architektur und Landschaft, er liebt das Organische, das Bauen mit Lehm, Mörtel, Gips und Stroh, die Verwendung von Pflanzen.
"Meine Bauten stehen in einem natürlichen Kreislauf, sie sind nicht für die Ewigkeit. Das ist ein Aspekt, der mir sehr gefällt: dass die Gebäude nicht zeitlos immer das gleiche Aussehen bewahren, sondern in die Natur eingefügt und der Natur ausgesetzt sind, dem Einfluss des Sonnenlichts, sie verbleichen, verwittern und setzen Patina an", sagt Fujimori.
Vom Architekturhistoriker zum Architekten
Die phantastische Baukunst des hierzulande noch wenig bekannten Japaners zeigt nun eine Ausstellung in der Münchner Villa Stuck, mit dem schlichten Titel "Terunobu Fujimori, Architekt". Die von Hannes Rössler kuratierte Schau präsentiert Modelle, Materialtafeln, Zeichnungen und Fotos von Wohnhäusern, Museen und Bädern, Werkstätten und Teehäusern.
"Fujjimori zeigt uns einen vollkommenen Unterschied im Umgang mit Natur, mit Baumaterialien und der Historie der Architektur ebenso wie er im Dialog mit der gegenwärtigen Architektur eine ganz neue Position einnimmt", meint Hannes Rössler.
Terunobu Fujimori, geboren 1946, arbeitete zunächst als Architekturhistoriker, beschäftigte sich mit Aspekten der Städteplanung und gründete die "Roadway Observation Society", eine Gesellschaft von "Architekturdetektiven", die auf den Straßen Tokios nach interessanten Funden suchten und diese fotografierten.
Erst mit Mitte 40 baute Fujimori sein erstes Haus, das ihn schlagartig bekannt machte: das "Historische Museum der Priesterfamilie Moriya", ein zweiteiliger Bau aus einem turmartigen Element mit quadratischem Dach und einem keilförmigen mit Schrägdach, das von zwei Baumstämmen durchstoßen wird. Das aus der hügeligen Waldlandschaft hervorstechende Gebäude, das natürliche Materialien charakterisieren: Schieferziegeln und Außenwände aus Erde und Spaltbrettern, sieht aus "wie das Werk eines Verrückten", meinte Fujimoris Architektenkollege Toyo Ito, und er meinte das als Kompliment.
"Die Bauten sollen nicht vergleichbar sein. Das ist eine der Grundbedingungen für sein eigenes architektonisches Schaffen. Die Gebäude sollen nichts ähneln, was nach der Bronzezeit gebaut wurde. Er wird von seinen Architektenfreunden, die alle zur japanischen Architekturavantgarde gehören, zu den ganz bekannten Namen, 'Steinzeit-Daddy' genannt. Er bezieht sich auf Formen, die tief in uns drin stecken, die wir spüren, wenn wir seine Architektur anschauen", sagt Hannes Rössler.
Im Zentrum steht die Schönheit
Terunobu Fujimoris Architektur wirkt kindlich und verspielt, verträumt und verwirrend, humorvoll und improvisiert, sie zeugt von Experimentierlust, Traditionsbewusstsein und großer Phantasie. Fujimori sucht den Dialog mit der Natur, ist aber kein Apostel der Nachhaltigkeit oder ökologischen Effizienz. Ihm geht es vor allem um Schönheit. Eine Stahlbetonwand ist praktisch, aber nicht schön, er benutzt sie, aber er liebt sie nicht, sie wird ummantelt mit Mörtel, Baumrinde, verkohltem Holz oder unebenen Kupferblechen – Materialien mit Charakter, mit taktilen Reizen, mit der Anmutung des Archaischen und Einfachen.
Terunobu Fujimori baut ein "Löwenzahnhaus" und das "Kamelienschloss", das Nemunoki Kunstmuseum für Kinder und das "Haus der einsamen Kiefer", einem ehemaligen japanischen Premierminister errichtet er eine Töpferwerkstatt und das "Teehaus für eine Nacht", eine kleine Baumhaus-Idylle an einem bewaldeten Hang.
Teehäuser als Parallelwelten
Teehäuser sind seitdem seine liebste Bauaufgabe. Er realisiert das verwunschen wirkende Teehaus Tetsu und das kühn in den Himmel gereckte Teehaus Irisen, das "Teehaus im rechten Winkel" und sein eigenes Teehaus, das "Zu hohe Teehaus", in das man nur über eine sechseinhalb Meter hohe Leiter gelangt. Es thront auf zwei, nicht auf drei mächtigen Baumstämmen, mit drei Stützen zu bauen, so Fujimori, "ist zu stabil und langweilig".
"Seine Teehäuser sind Parallelwelten… Wir steigen eine Treppe hinauf, schlüpfen durch ein enges Türchen hindurch, sitzen in einem kleinen, höhlenartigen Raum, schauen durch kleine Fenster auf die Welt hinaus, man kann uns gar nicht sehen von außen. Er bietet uns damit die Chance, zur Ruhe zu kommen, uns zu besinnen, zu reflektieren, uns neu in der Welt zu verorten, indem wir in einen solchen zeitlosen Ort hinein steigen", erklärt Hannes Rössler.
Ein Haus aus einem Stück
Fujimoris Werke sind überwiegend kleinere Gebäude für den ländlichen Raum. Metropolen inspirieren ihn eher zu postapokalyptischen Visionen. Ein Modell zeigt seine Vorstellung von Tokio in hundert Jahren. Die globale Erwärmung hat den Meeresspiegel ansteigen und die Stadt versinken lassen. Unter dem Meeresspiegel verwachsen die Wolkenkratzer mit Korallenriffen, auf den verbliebenen Landmassen entstehen Gebäude aus den Wäldern der Berge und sogenannte "Sprossen der Erde", riesige Türme aus Lehm, in denen es Pflanzen gibt, Insekten und Reptilien.
Aber Fujimori beschäftigt nicht nur die Welt nach dem großen Alptraum: "Einer meiner Träume ist es, aus einem Riesenbaum, mit zehn Meter Durchmesser oder noch mehr, ein ganzes Haus zu schnitzen – ein Haus aus einem Stück. Ein anderer Traum ist, dieses Holz nicht zu schnitzen, sondern dem Feuer auszusetzen. Ein Brand soll ein Haus erschaffen, mit den Flammen als Architekt, als Symbol nicht für Zerstörung, sondern für kreative Kraft."
Fujimoris bislang letztes Projekt ist die Version eines Teehauses für den Garten der Villa Stuck, das "Walking Café". Ein von Handwerkern, Studenten und Kindern gemeinsam errichtetes kleines, eiförmiges Häuschen, das auf Stelzen mit Rädern steht und durch die Stadt gezogen werden kann. "Ich möchte eine Architektur schaffen", sagt Terunobu Fujimori, der Einzelgänger unter den Avantgardisten der Gegenwart, "bei deren Entstehung sich Menschen zusammenfinden, gemeinsam bauen und feiern".

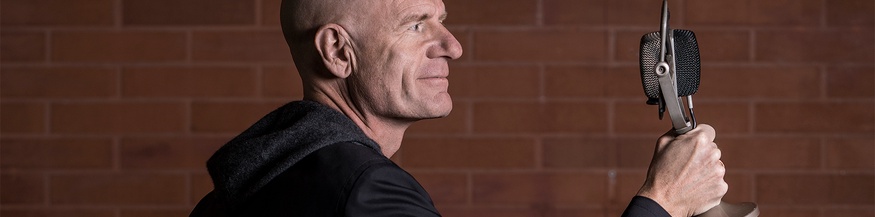


![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/|CC BY-SA 4.0] Emmet Cohen](/i/related_content/0a/3a/0a3a2e9664f248bc7d6749e38f871efca373d511.jpg)
