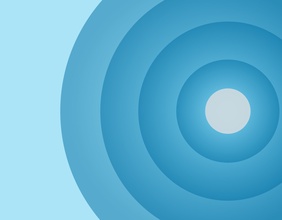Was wir zum Überleben brauchen
Das Floß der Medusa
"Das Floß der Medusa" heißt ein berühmtes Bild, gemalt 1819 von Théodore Géricault. Es zeigt eine Gruppe nackter und halbnackter Menschen zwischen Leblosigkeit und Verzweiflung, zusammengedrängt auf einem morschen Floß, das zum Spielball der Wellen geworden ist.
8. April 2017, 21:58
Das Bild beruht auf einem realen Vorfall. Im Sommer 1816 war die französische Fregatte "Medusa", eines der schnellsten und modernsten Schiffe seiner Zeit, mit 400 Mann Besatzung auf dem Weg nach Senegal, als es auf eine Sandbank auflief. Der Kapitän, ein königstreuer Graf, war nicht seeerfahren und hatte die Gefahren unterschätzt. Um das Schiff wieder flott zu kriegen, hätte man es leichter machen und Ladung über Bord werfen müssen. Doch die Verantwortlichen wollten sich weder von ihren Kanonen, nach von ihren Mehlfässern trennen.
Die Besatzung geriet in Streit. Dann kam ein Sturm, und der Kiel brach. Auf den mitgeführten Booten wollten die Offiziere die Küste erreichen, der Rest der Besatzung sollte sich auf einem eilig gezimmerten Floß in Sicherheit bringen. Doch das Floß war viel zu klein, als 150 Passagiere an Bord waren, war es schon hoffnungslos überladen. Manövrierunfähig trieb es tagelang im Meer, die Männer hatten keinen Proviant, litten unter Hunger und der sengenden Sonne, wurden über Bord gespült oder töteten sich in ihrer Verzweiflung selbst, brachten andere um und verfielen in Kannibalismus. Als das Floß nach knapp zwei Wochen aufgespürt wurde, waren noch fünfzehn Menschen am Leben, fünf davon starben später an Land.
Augen zu
"Das Floß der Medusa" - die Geschichte eines Unglücks, das erst eine unfähige Führung und falsche Notfall-Strategien zur Katastrophe werden ließ, aber auch Ignoranz und Verblendung. Der Mensch will das Risiko nicht sehen, sagt der Psychologe Wolfgang Schmidbauer, der sein neues Buch über das Dilemma der Konsumgesellschaft mit dem Schiffbruch der Medusa beginnt. "Wenn die Katastrophe eingetreten ist, leugnet er immer noch ihren Umfang und ihre möglichen Folgen."
"Ich denke, das ist einfach eine Geschichte, über die man viel nachdenken kann; dass man sagt, wir haben begrenzte Ressourcen, und wir müssen jetzt die Kreativität freisetzen", sagt Schmidbauer. "Wenn das getan worden wäre, dann wäre es sicher so passiert, dass kleine Gruppen Flöße gebaut hätten, mit denen man wirklich die nur 30 Kilometer entfernte Küste erreicht hätte, sicher und wohlbehalten. Es gab ja da Zimmerleute, es gab Handwerker, es gab sicher sehr viel Intelligenz und Kreativität an Bord, aber es wurde nicht gemacht, es wurde nicht freigesetzt. Sondern es wurde von oben herunter entschieden, so und so machen wir es. Die Geschichte ist einfach eine gute Warnung."
Das Floß der Medusa sei "ein Lehrbeispiel für die Verleugnung vermeidbarer Gefahren und den Zerfall sozialer Strukturen unter dem Druck von Eitelkeit und Egoismus". Gerade deshalb sei diese Geschichte aktuell - in einer Zeit der Klima-, Energie-, Finanz- und Wirtschaftskrise, die, wenn wir so weitermachen wie bisher, zur Katastrophe führen wird. Wenn wir, wie die Besatzung der Medusa, nicht die Gefahren richtig einschätzen und uns nicht beizeiten um tragfähige Flöße, sprich: ressourcenschonende Lösungen, kümmern.
Die "Illusion der Konsumwelten"
"Wir leben wirklich von der Substanz, und es ist da noch keine klare Umkehr in Sicht", meint Schmidbauer. "Alle Versprechen, sowohl was die Reduzierung von schädlichen Gasen in der Klimakatastrophe angeht, als auch was die Verschwendung von Rohstoffen angeht, sind ja nie wirklich konsequent eingelöst worden. Ich würde als Psychologe auch sagen, das ist auch zu erwarten, weil Menschen nicht aus guten Vorsätzen lernen."
Wolfgang Schmidbauer analysiert zunächst Aspekte der Konsumgesellschaft, die er auch "globales Überflusssystem" oder "globalisierte Wachstumswirtschaft" nennt und auf einem gefährlichen Weg sieht, um anschließend mögliche Alternativen zu diskutieren.
"Die Konsumgesellschaft", so der Autor, "ist das erste Experiment in der Geschichte, in dem jedem Individuum versprochen wird, es habe das Recht, über seine Verhältnisse zu leben". Er nennt das "die zentrale Illusion der Konsumwelten".
Immer mehr Menschen wollen immer mehr Güter, Waren und Produkte, immer neuere, exklusivere, prestigeträchtigere und scheinbar leistungsfähigere. Identität wird in dieser Gesellschaft ganz wesentlich als Teilhabe an solch stark idealisierten Konsumgütern begriffen. Diese versprechen Komfort und Bequemlichkeit.
Konsum macht süchtig
Doch die Konsumgesellschaft führt nicht nur ökonomisch, sozial und ökologisch in die Sackgasse, weil sie immer mehr Schulden produziert, zu sozialen Ungerechtigkeiten führt und zum Raubbau an den Ressourcen, sondern auch psychologisch. Konsumgüter machen süchtig, unfrei und abhängig. Nicht wir besitzen die Dinge, die Dinge besitzen uns. Sie nehmen uns Arbeit ab, stürzen uns aber auch in tiefe Hilflosigkeit, wenn sie versagen.
Zitat
Wir bräuchten Produkte, die unseren kritischen Bezug zur Wirklichkeit verbessern, die uns vernünftige Verhältnisse zwischen Aufwand und Ertrag sinnfällig machen. Aber wir haben Güter, die uns Verschwendung, Sucht nach maximaler Bequemlichkeit, Angst vor Anstrengung und Größenfantasien jeder Art beibringen.
"Niemand denkt daran, dass diese Dinge etwas sind, was uns psychologisch überfordert", so Schmidbauer, "wenn alles automatisiert ist und jemand, der das Ding bedient, überhaupt nichts mehr begreifen muss, also in seiner seelischen Entwicklung eigentlich auf einem ganz infantilen Stadium bleiben kann. Und so sind ganz viele Dinge beschaffen, dass sie den Menschen eigentlich nichts mehr beibringen und dass dadurch ja auch diese Abhängigkeit von Komfort enorm verstärkt wird. Dass es fast unmöglich ist sich vorzustellen, dass eine andere Welt schön sein und eigentlich viel produktiver für uns sein kann - dass wir eigentlich da viel besser reinpassen."
Lob der Handarbeit
Dem Prinzip des Konsumismus, dem Prinzip, immer mehr vom "Guten" selbst zu besitzen und alles "Schlechte" nach außen zu verlegen, was Schmidbauer auch als "Faschismus der Ware" bezeichnet, wird das "Lob der Handarbeit" entgegengesetzt. Wer mit dem Messer Bleistifte spitze oder mit der Sense die Wiese mähe, fördere nicht nur seine motorischen Fähigkeiten. Er lerne von den Dingen, pflege ein sinnliches Verhältnis zur Umwelt, frei von Fortschrittswahn und Wegwerfmentalität.
In seinem auch von persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen berichtenden und manchmal auch ein bisschen nostalgisch anmutenden Buch preist Schmidbauer die "Bastelkünste" als "Zukunftswerkstatt", singt das Lob der Kesselflicker, Drahtflechter und Störschneider und äußert sogar Sympathie für den Pfusch: Hier herrsche Improvisationskunst, Nachhaltigkeit, ein kreatives, "anarchisches" Denken. Bastler, so der Autor, seien denn auch vor vielen psychischen Gefahren des Konsumismus geschützt. Diese sind unter anderem Frustration, Aggression und Autoaggression, Burnout und Depression.
"Wenn jemand das Gefühl hat, er ist in seiner Arbeit schöpferisch und er kann aus allem, was er macht, was lernen, so dass seine Arbeit ihm immer besser gelingt, dann ist das der beste Schutz vor Burnout", meint Schmidbauer. "In diese Richtung müssten wir gehen. Ich glaube, dass das uns wegbringen würde von dieser Idee, dass Komfortsteigerung, also die Steigerung von Bequemlichkeit, das Ziel ist. Das Ziel ist eigentlich die Steigerung von Kreativität."
Teilen, um mehr zu bekommen
Wie Alternativen zur bestehenden Konsumgesellschaft aussehen könnten, darüber informiert Schmidbauer am Ende des Buches. Er spricht von einer an nachhaltigen, an langlebigen und reparaturfreundlichen Dingen orientierten Wirtschaft, von überschaubaren, flexiblen, nicht hierarchisch-autoritär konzipierten Strukturen – und schreibt über "Urban Gardening" als Projekt der Gestaltungslust und Selbstversorgung und über "offene Werkstätten" als Möglichkeit des Miteinander-Arbeitens und -Lernens, er erwähnt ein Bioenergiedorf in Deutschland, das Biomasse und Gülle in Biogas umwandelt und damit doppelt so viel Strom erzeugt als es verbraucht, und findet auch den Versuch einer amerikanischen Kleinstadt attraktiv, die eine durch Lebensmittel gedeckte Regionalwährung einführte: Für jeden Kredit werden Sicherheiten in Form von Reis, Getreide oder Bohnen hinterlegt.
Am Interessantesten und Vielversprechendsten aber ist das System der "Commons", der Allmenden oder Gemeingüter, wie es die amerikanische Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom entwickelt und in ihrem Buch "Was mehr wird, wenn wir teilen" vorgestellt hat. Hier beschreibt sie den gesellschaftlichen Wert von Gemeingütern, die von Menschen so genutzt werden, dass eben nicht das Einzelinteresse und der schnelle Profit im Vordergrund stehen, sondern der Erhalt und damit auch die langfristige Nutzungsmöglichkeit des Gutes.
"Wenn alle Fischer um einen See herum, wenn sich die zusammensetzen und sich fragen, was könnten wir machen, dass wir in fünfzig Jahren auch noch Fische fangen - die finden eine Lösung", denkt Schmidbauer. "Aber wenn es das Weltmeer ist und die sind an der Küste, dann denkt jeder, wenn wir jetzt schneller mehr, dickere Fischerboote bauen, dann können wir ganz viel Umsatz machen, ganz viel gewinnen, und denken nicht an diese Allgemeinheit. Und ich denke, dass nicht ein Einzelner die ganzen Komplexitäten so überblicken kann, dass er eine Lösung findet, sondern dass es wirklich wichtig ist, sich zu vernetzen, dass man Gruppen findet, die zusammen versuchen, eine Lösung zu finden."
Glaube an die Kreativität
Die Struktur der "globalisierten Wirtschaft" ist instabil, "sie kann in der bisherigen Bewegung nicht fortfahren. Wenn sie das tut, steuert sie auf einen Systemabsturz zu", schreibt Wolfgang Schmidbauer in seinem neuen Buch, das sich kritisch mit dem "homo consumens" auseinandersetzt, mit Eventkultur, Fortschrittsideologie und Wachstumswahn, mit einem System, das wir, wie der Autor meint, "nicht als etwas erleben, das unsere Existenz sichert, das uns Sicherheit und Geborgenheit gibt und auf das wir stolz sein können".
Er kennt zwar kein schlüssiges Konzept einer postkonsumistischen Gesellschaft, aber er glaubt an die menschliche Kreativität und an beispielgebende Alternativen. Schmidbauer argumentiert knapp und klar, ohne Besserwisserei, aber doch entschieden in den Ansichten, manchmal vielleicht etwas vereinfachend und zu blauäugig den sogenannten "traditionellen Werten" gegenüber, aber nie bloß reißerisch oder düster-pessimistisch.
Er hofft, dass wir zweihundert Jahre nach dem Untergang der "Medusa" unsere Lektionen aus der Katastrophe doch noch lernen mögen; dass wir leeren Versprechungen und falschen Kommandos nicht folgen und uns auf unserem havarierten Schiff rechtzeitig um sichere Rettungsflöße sorgen mögen. "Mit weniger Komfort, aber heiler Haut könnten dann", so Schmidbauer, "Passagiere und Mannschaft ein Ufer suchen oder Rettung abwarten."
service
Wolfgang Schmidbauer, "Das Floß der Medusa. Was wir zum Überleben brauchen", Murmann Verlag
Murmann - Das Floß der Medusa