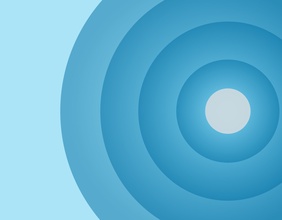Was unsere Gesellschaft zusammenhält
Zusammenarbeit
Auf die Frage, was denn unsere Gesellschaft zusammenhalte, gibt es keine schlüssige Antwort. Ist es die Politik, sind es Institutionen, ist es die Kultur oder doch eher eine Weltanschauung?
8. April 2017, 21:58
Sind es Werte oder ist es ein genetisches Programm, das uns zu sozialen Wesen formt? Es ist irgendwie alles und doch nichts Spezielles.
Unter Soziologen wird sogar angezweifelt, ob es überhaupt noch so etwas wie Gesellschaft gebe, jedenfalls im Sinne eines territorial begrenzten Gesellschaftskörpers. Gibt es die österreichische Gesellschaft? Oder müssen wir nicht eher von einem Konglomerat aus Teilgesellschaften sprechen, die miteinander mehr oder weniger lose vernetzt sind, die sich aber nicht mehr in einem Staat aufgehoben fühlen?
Richard Sennett kennt diese Diskurse, war er doch mit seinem Buch "Der flexible Mensch" selbst daran beteiligt. Nun aber scheint es so, als wolle er sich nicht mehr mit der gesellschaftszersetzenden Kraft des Kapitalismus befassen, mit all diesen Befunden der Vereinzelung durch den alle Biografien des modernen Menschen durchdringenden Wettbewerbsdruck. Er will, so scheint es, nicht mehr nur an Entsolidarisierung und Desintegration glauben, sondern an eine natürliche Widerständigkeit des Individuums.
Zusammenarbeit erfordert bestimmte Fähigkeiten
Wobei glauben das richtige Wort ist, denn Sennett bewegt sich mit seinem neuen Buch ziemlich auffällig von der Soziologie als Wissenschaft hin zu einer Philosophie als Lebenskunst – zu einer praktischen Philosophie, die davon ausgeht, dass, vereinfacht gesagt, das Gute vor unseren Füßen liegt. Man muss es eben nur sehen.
Seine Basisdefinition von Zusammenarbeit sei sehr einfach, sagt Richard Sennett: Menschen kooperieren, weil sie Dinge tun, die sie alleine nicht tun können.
Für Zusammenarbeit brauche es gewisse Fähigkeiten, meint Richard Sennett, der Instinkt alleine reiche dafür nicht aus. Wir müssten wieder lernen zuzuhören, wenn wir etwas verstehen wollen. Wir müssten einfach wieder in der Lage sein, mit Fremden zu kommunizieren.
Viele Argumente
Natürlich wird Sennett nie banal, dazu verfügt er über zu große Kenntnisse der Geschichte, der Politik, der Soziologie, der Philosophie, der Anthropologie, der Künste, und er vermag all diese Kenntnisse argumentativ fruchtbar zu machen.
Man hat den Eindruck, dass es nichts gibt, was der Mann nicht kennt, das reicht vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von China bis ins rote Wien. Und weil Sennett zudem ein ausgebildeter Cellist ist, weiß er auch ziemlich viel über Musik zu sagen.
Die Fähigkeit zu kooperieren
Sennett ist ein neugieriger Mensch, und neugierige Menschen sind in der Regel sozial aktiv, weil sie, metaphorisch gesprochen, gerne in andere Leute hineinschauen, das Gegenüber ergründen, am Leben anderer teilhaben.
Diese Neugier ist es auch, die Sennett als eine Eigenschaft hervorhebt, die nicht ihn allein auszeichnet, sondern die den Menschen inhärent ist. Sie sei nur oft verstellt durch Regeln, Pflichten, Arrangements, meint er, und es gelte, das Gerümpel wegzuräumen und zu sehen, dass uns eine Fähigkeit gegeben ist, die man als anthropologische Konstante bezeichnen kann: die Fähigkeit zu kooperieren.
Herkömmliche Rollen verlassen
Komplexe Zusammenarbeit fange erst dann an, wenn Menschen die Rollen verlassen, die man ihnen zugeteilt hat, und sich von sich aus einbringen und aktiv werden, sagt Sennett.
Die Menschen müssten erst einmal die herkömmliche Arbeitsteilung überwinden und nicht nur das tun, was vorgeschrieben ist. Sie müssten zu Deserteuren ihrer vorgegebenen Rollen werden. Dabei entsteht Kritik, auch Selbstkritik, und damit entstehen neue Themen, neue Gespräche, aber eben auch neue Töne.
Kommunikation ist das Zauberwort
Wir müssen versuchen, der mechanischen Aktivität zu entkommen, meint Sennett, auch der strikten Arbeitsteilung, um diese komplexe Form der Zusammenarbeit zu erreichen.
Diese Fähigkeit, an die Sennett eher glaubt als dass er sie beweisen kann – wie auch? – ist schließlich jener Stoff, der eine Gesellschaft zusammenleimt. Denn wenn wir es im Alltag mit Menschen zu tun haben, die wir nicht kennen, mit denen uns nichts verbindet oder die wir nicht mögen – mit lauter vereinzelten, unter Konkurrenzdruck stehenden Menschen also, verfügen wir vor allem über die kommunikativen Fähigkeiten, mit diesen Menschen zu kooperieren.
Kommunikation ist das Zauberwort. Oder kommunikatives Handeln, um einen Begriff von Jürgen Habermas zu verwenden, den Sennett zwar nicht zitiert, der aber hinter seinem Rücken hervorschaut, gerade in dieser Wunschvorstellung von einer idealen, macht- und gewaltfreien, wie ein Handwerk zu erlernenden Form der Verständigung.
Eine nicht-mehr-und-noch-nicht-Zone
Man kann sagen: Richard Sennett verweigert sich dem Pessimismus. Das Ende der Gesellschaft, Entsolidarisierung, Vereinzelung – das sind für ihn die Befunde der radikalen Vereinfacher der Moderne.
Er ist vielmehr überzeugt davon, dass wir in einer nicht-mehr-und-noch-nicht-Zone leben, in der sich noch nichts entschieden hat. Wenn wir lernen, unserer Fähigkeit, ja unserem Drang nach Kooperation durch Kommunikation freien Lauf zu lassen, zu entwickeln und zu verfeinern, spricht nichts dagegen, dass wir entgegen vieler Prognosen in Zukunft von einer solidarischen Gesellschaft sprechen können, die in der Lage sein wird, viele Verheerungen der kapitalistischen Marktwirtschaft aufzufangen.
Service
Richard Sennett, "Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält", Hanser Berlin