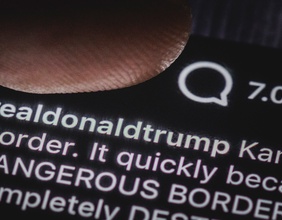Das "Haremskonfekt"
Lübecker Marzipan
Wer an Lübeck denkt, der denkt fast immer auch an Marzipan, auch wenn einige andere Städte - Tallin oder Königsberg etwa - den Anspruch erheben, das Marzipan sei in ihren Mauern erfunden worden. Denn um die Herkunft des Marzipans ranken sich die unterschiedlichsten Geschichten.
8. April 2017, 21:58
Eine der beliebtesten ist diese: Im 15. Jahrhundert wütete in Lübeck eine Hungersnot. Es gab kein Korn mehr, allerdings noch Mandelvorräte in den Speichern. Da trug der Senat den Bäckern auf, aus diesen Mandeln ein Brot herzustellen.
Eine andere Legende bezieht sich auf den Namen: Das Marzipan sei das "marci panis" aus Venedig, das Brot des Markus. Sprachforscher hingegen sind der Meinung, der Name Marzipan leite sich von der byzantinischen Münze Mauthaban ab. Das Wort wurde später zu Marzapane abgewandelt - im Mittelmeerraum war das die Bezeichnung für "Spanschachtel". Irgendwann soll dann der Name der Verpackung auf den süßen Inhalt übergegangen sein. Als sicher kann wohl nur gelten, dass Marzipan aus dem Vorderen Orient stammt.
Export in die ganze Welt
In den Lübecker Zunftrollen wird "Martzapaen" erstmals im Jahre 1530 erwähnt. Lübecks Ruf als "Marzipanstadt" wurde aber erst nach 1800 begründet. Heute weiß man nicht mehr so genau, wie es damals zugegangen ist: war es ein besonders kunstfertiger und ideenreicher Konditor, der den Grundstein dieser Erfolgsgeschichte legte, oder ein Wettbewerb unter den verschiedenen, damals schon sehr arrivierten Lübecker Konditoreien?
Fakt ist, dass es heute in der Hansestadt Lübeck mehrere große Firmen gibt, die Lübecker Marzipan herstellen und in die ganze Welt exportieren. Eine der wichtigsten ist sicherlich Niederegger mit Sitz in der Lübecker Altstadt: In dem Café in der Breite Straße 89 wird neben all den Klassikern aus Marzipan auch die berühmte Niederegger Nusstorte mit Marzipanumhüllung angeboten, und im ersten Stock, im sogenannte Marzipan-Salon, wird ein kleines Museum betrieben.
Schon im Jahr 1648 wurde der Lübecker Weihnachtsmarkt urkundlich erwähnt. Seit1714 dürfen die Lübecker Zuckerbäcker Marzipan herstellen, erzählt Eva Mura, die sich schon seit zehn Jahren mit dem Marzipan und seiner Vermarktung befasst. Schon der persische Arzt Rhazes, der von 850 bis 923 lebte, hatte das Gemisch aus Mandeln und Zucker als Heilmittel gepriesen, das aber bald von Kalifen und Haremsdamen als delikate Süßspeise genossen wurde.
Luxuskonfekt für die Reichen
Dass sich in Lübeck diese Geschmackskultur entwickeln konnte, ist sicher dem Umstand zu verdanken, dass Lübeck eine Hansestadt und Umschlagpatz für Rohstoffe aus aller Welt war. Die gewaltigen Hanse-Koggen brachten die Mandeln - vornehmlich aus dem persischen Raum - nach Lübeck. Rohrzucker war in der damaligen Zeit höchst kostspielig, daher war Marzipan bis zum 19. Jahrhundert, bis die erste Rübenzucker-Fabrik 1801 ihre Arbeit aufnahm, für die einfachen Bürger praktisch unerschwinglich. In diesen Jahren machte sich der aus Ulm stammenden Konditor Johann Georg Niederegger, der bislang in der Mareeschen Konditorei gearbeitet hatte, selbstständig.
Als kurz darauf Napoleon die Kontinentalsperre einrichtete und Niederegger Mandeln und Zucker ausgingen, konnte Niederegger nur durch Schmuggel über die Insel Helgoland den Betrieb aufrecht erhalten. Nach dieser etwas schwierigen Anfangsphase war die Erfolgsgeschichte des Niederegger Marzipans nicht mehr zu verhindern. Besonders in den Wintermonaten läuft die Produktion auf Hochtouren.
Um geheimnisvolle Rezepte, Spionage und den Kampf um die wirtschaftliche Vormachtstellung in der Lübecker Marzipan-Welt ranken sich einige historische Romane, wie etwa das Buch "Das Marzipanmädchen" von Lena Johannson und "Lübecker Marzipan oder fünfzehn Rosen" von Harald Eschenburg, aber auch der vor zwei Jahren gedrehte Fernseh-Vierteiler "Der letzte Patriarch" mit Mario Adorf in der Hauptrolle. Marzipan ist für Lübeck ein Wirtschaftsfaktor geworden. Immerhin werden in der Weihnachtszeit pro Tag 30 Tonnen Marzipan hergestellt und in zwei bis drei Schichten wird gearbeitet.
Thomas Mann aus Marzipan
Im Marzipan-Salon im zweiten Stock des Hauses ist dezente Musik zu hören, das Licht ist gedämpft, in Glaskästen werden die unterschiedlichsten Gegenstände aus Marzipan präsentiert: täuschend echt modellierte Früchte, prunkvolle Fabergé-Eier, eine Nachbildung des historischen Viermasters "Passat" und die unterschiedlichsten Modeln. Eine Bildergalerie an der rot gestrichenen Wand gibt Einblicke in die Werksgeschichte und die lange Tafel wird von zwölf lebensgroße Figuren aus inzwischen steinhartem Marzipan umringt.
Darunter befinden sich der Gründungsvater des Hauses, Johann Georg Niederegger, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, der in seinem Werk Marzipan immer wieder als Liebesmedizin bezeichnete, und auch Zar Alexander II. Der russische Herrscher ließ sich, angeregt durch die vielen Preise, die das Niederegger Marzipan unter anderem auch auf der Wiener Weltausstellung im Jahr 1873 erhielt, lebensgroße Marzipangänse an den Hof kommen.
Auch der Lübecker Dichterfürst und Nobelpreisträger Thomas Mann wurde in Marzipan verewigt. Er zeichnet für die Wortschöpfung "Haremskonfekt" verantwortlich und bekannte sich bis zu seinem Tod im Jahr 1955 zu der geheimnisvollen Beziehung zwischen seiner Heimat und "dem Märchen, dem östlichen Traum". Dieser besonderen Beziehung zwischen dem Schriftsteller und der süßen Köstlichkeit wird auch im Niederegger-Shop Rechnung getragen: das klassische Marzipan mit der Zartbitterschokolade wird dort in einer der Originalausgabe von den "Buddenbrooks" nachempfundenen grünen Schachtel verkauft.
Übersicht
- Reisen