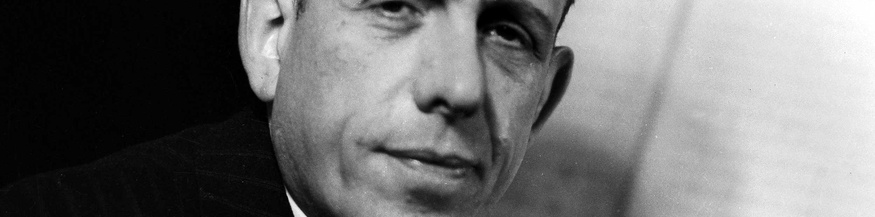Sowjetische Augenzeugen berichten
Die Stalingrad-Protokolle
Am 30. Januar 1943 verliest Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast eine Rede Hitlers. Der ist verhindert, unabkömmlich im "Moment des schwersten Ringens des deutschen Volkes"; Hitler war mit den "Abwehrschlachten im Osten" befasst. Die Rede ist von Stalingrad, wo die 6. Armee des General Paulus gerade unterging.
8. April 2017, 21:58
Zuletzt beschwört Goebbels auf bekannt hysterische Weise Europa, dessen Schicksal sich in Stalingrad entscheide: "Der Heldenkampf unserer Soldaten an der Wolga soll für jeden eine Mahnung sein, das Äußerste zu tun - im Kampf um Deutschlands Freiheit und unseres Volkes Zukunft und damit im weiteren Sinne für die Erhaltung unseres ganzen Kontinents."
Wir wissen, wie es ausging: Drei Tage später, am 2. Februar 1943, kam die Kapitulation. Es folgten ein bombastische Staatstrauer, aus dem Radio ertönte Wagner, sie hatten ihn verdient: 150.000 deutsche Soldaten sind in den Kämpfen und infolge von Hunger an der Wolga gestorben; ca. 110.000 Mann marschieren in sowjetische Kriegs-Gefangenschaft, die 6.000 schließlich überlebten.
Die von der Schlacht in Stalingrad ausgehende obskure Faszination hat seit siebzig Jahren nicht nachgelassen: Um Stalingrad ging es in der Nachkriegszeit in den Memoiren deutscher Generäle und in unzähligen Landser-Heften; an Stalingrad haben sich die Bücher der Kriegsgegner abgearbeitet: Alexander Kluges "Schlachtbeschreibung" in den 1960er Jahren ebenso wie Walter Kempowskis kollektives Tagebuch "Echolot" aus den 90er Jahren. Stalingrad war - zynisch gesprochen - immer ein deutscher Bestseller.
Von der "anderen" Seite her
Kaum anders verhält es sich mit den "Stalingrad-Protokollen" des jungen deutschen Historikers Jochen Hellbeck: Hellbeck baut zuerst einen Popanz auf - die Schlacht werde noch immer als eine "germanozentrische Geschichte" und als "Geschichte eines deutschen Opferganges" erzählt - um sogleich selbst mit seiner eigenen Erzählung, wie es wirklich war, zu beginnen: Diesmal von der anderen, der sowjetischen Seite her gesehen.
Zitat
Die sowjetischen Verlustzahlen sind im Westen kaum bekannt. Im Unterschied zum Gesamtbild von der Wehrmacht an der Ostfront, das in den letzen beiden Jahrzehnten sehr kritisch und nicht ohne pauschale Überzeichnung beleuchtet worden ist, hält sich bis heute eine bemerkenswerte unkritische und insulare Sicht auf die Schlacht von Stalingrad, in der deutsche Soldaten primär als Opfer figurieren und die gegnerischen Seite gar nicht oder nur kaum Erwähnung findet.
Richtig daran ist: Tatsächlich waren nicht alle Soldaten des sogenannten "Ostfeldzuges" Verbrecher und auch die Zahl der sowjetischen Verlust ist im Westen kaum ein Begriff: die Rote Armee verlor in Stalingrad 1,130.000 Mann - Verwundete und Tote zusammengezählt; einige russische Forscher sprechen heute von bis zu einer Million an der Wolga gefallenen Rotarmisten; 7.566 Bewohner der Stadt überlebten die Schlacht. Dass Stalingrad in deutschen Landen aber noch immer nur aus deutscher Sicht wahrgenommen würde, ist nach dem sensationellen Erfolg von Wassili Grossmanns Roman "Leben und Schicksal" vor etlichen Jahren gelinde gesagt propagandistischer Unfug in eigener Sache - Buchmarketing.
Zeitzeugengespräche aufgezeichnet
Einen sensationellen Fund stellen Jochen Hellbecks "Stalingrad-Protokolle" dennoch dar: Knapp vor dem Ende der Schlacht begann eine sowjetische Kommission unter der Leitung des Historikers Isaak Minz Zeitzeugengespräche mit Hunderten Teilnehmern des Kampfes aufzuzeichnen. Gesprochen wurde dabei mit Generälen und einfachen Soldaten aller Waffengattungen, mit Politkommissaren und Scharfschützen. Frauen kommen praktisch nicht vor.
Trauriges Schicksal des generalstabsmäßig durchgeführten akribischen Historikerprojektes: es blieb fast siebzig Jahre in irgendwelchen russischen Archivkellern liegen. Hellbeck hat die Akten vor einigen Jahren gefunden, sorgfältig kommentiert, wie es heute so schön heißt "kontextualisiert", und mit einem luziden einhundertseitigen Vorwort versehen:
Umrissen werden dabei die militärischen Aspekte der Schlacht; deren Bedeutung für den weiteren Verlauf des Kriegs wird analysiert. Kurz gesagt: Stalingrad wird wieder einmal zur Wende hochstilisiert. Hellbeck beschreibt Aufbau und Ideologie der Roten Armee seit Trotzki. Am spannendsten gerät die Beschreibung der Historikerkommission selbst, die ein quasi künstlerisches Verfahren wählte, wie es im sowjetischen "Produktionsroman" der 1920er Jahre entwickelt worden war. Dichtung und Wahrheit stellen in der Geschichtsschreibung immer schon die größte Herausforderung dar.
Zitat
In ihrer Gesamtheit fügen sich die Gespräche zu einem soldatischen Chor, der die von der neueren Forschung vertretene These vom Volkskrieg stimmgewaltig stützt. Die Soldaten sehen sich als aktive Teilnehmer des Kriegs, identifizieren sich mit dem Geschehen.
Ob die Rotarmisten in Stalingrad "für das Vaterland und für Stalin" kämpften, oder ob sie mitten im Krieg auf paradoxe und grausame Weise gerade Freiheit vom Terror des Stalinismus erlebten, wie in Russland heute oft behauptet wird - das zu entscheiden bleibt dem Leser freigestellt.
Mosaiksteinchen
Hellbeck entfaltete anhand der Gesprächsprotokolle stattdessen ein Panorama aus unendlich vielen Mosaiksteinchen: Da ist etwa auf höchst drastische Weise vom Scharfschützen Michail Mamekow und dessen Objekt der Begierde - die Rede:
Zitat
Er hat in kurzer Zeit schon 138 Fritzen getötet. Wenn er an einem Tag noch keinen Fritzen getötet hatte, kann er nicht essen, so fertig ist er mit den Nerven. Er ist ein typischer Tatare, spricht schlecht Russisch, dabei lernt er aber ständig russische Vokabeln, sogar im Kampf.
Breiten Raum nimmt die Darstellung des weniger gangsterhaft anmutenden üblichen soldatischen Alltages ein: Hunger und Angst, die Mühen des Häuser- und Nahkampfes; Militärisches auf Kommandoebene und die "Politarbeit" - die rote Armee kämpft schließlich eine ideologisch höchst aufgeladene Schlacht. Die "Fritze" nötigen dem Gegner Respekt ab, unterliegen "dem Iwan" aber auch wegen ihrer rassistischen Überheblichkeit.
Großrussischer Chauvinismus
In Stalingrad beweisen die Rotarmisten erstmals, was sie im Krieg können, auch wenn die rabiate Robustheit ihrer Kriegsführung zu unendlich vielen Opfern in den eigene Reihen führen. Man liest von den offiziell normierten Wodka-Zuteilungen (100 Gramm) vor dem Kampf; aus vielen Perspektiven wird die Eroberung des Mamajew-Hügels berichtet, ebenso multiperspektivisch erfolgen Gefangennahme und Verhör des General Paulus, den Hitler im letzten Moment zum Feldmarschall befördert hatte, um diesem den Selbstmord nahezulegen.
Zu mehr Insubordination als den Freitod zu verweigern war der Kommandant der 6. Armee nicht imstande. Heldentum in den Reihen der Arbeiter- und Bauernarmee ist ein Hauptthema, verschwiegen wird aber auch nicht der großrussische Chauvinismus, der während der Kämpfe an der Wolga immer deutlicher zutage trat. Usbekische Soldaten galten in der zunehmend rassistischen Roten Armee als besonders feige.
Abgehandelt wird auch Stalins berühmter Haltebefehl Nummer 227, der jegliches Zurückweichen untersagte - im besetzen Stalingrad bedeutete das: "Es gibt für uns kein Land hinter der Wolga." Wer dennoch zurückweicht, wird erschossen - und zwar von den verrufenen Sperrbataillonen des KGB-Vorläufers NKWD: Über all dem thront auf russischer Seite schließlich das Pathos des heiligen und gerechten großen vaterländischen Krieges:
Zitat
Jeder Tropfen ist ein kostbares Opfer auf dem Altar des Vaterlandes. Wenn sich jemand schuldig gemacht hat, kann er sich im Kampf von dieser Schuld lösen. Ich sagte ihnen, dass sie ihre Schuld vor dem Volk abwaschen müssen. Einige von ihnen riefen "Hurra" und erklärten, "wir werden das beweisen!"
Verhängnis der russischen Geschichte
Der Schriftsteller Wassili Grossmann, der für Jochen Hellbeck eine Art Generalzeuge der Schlacht von Stalingrad darstellt (und dessen Zeitungsartikel "Hauptstoßrichtung" in das Buch aufgenommen wurde, obwohl es mit den Stalingrad-Protokollen in keinerlei Verbindung steht) sah in der Schlacht an der Wolga ein Verhängnis der russischen Geschichte; nicht nur der Geschichte des Sowjetunion, sondern der russischen Geschichte überhaupt:
Zitat
Die Geschichte Russlands wurde nun als Geschichte des russischen Ruhms und nicht als Geschichte der Leiden und Erniedrigungen der russischen Bauern und Arbeiter aufgefasst.
Das bedeutet nicht, dass die Russen die Schlacht von Stalingrad verlieren hätten sollen, aber der weitere Kriegsverlauf wurde in Stalins Händen zu einem blutigen Triumphzug, der 1945 schließlich mit der Errichtung eines Imperiums endet, wie es die Weltgeschichte bis dahin nicht gesehen hatte.
Der Traum davon erwies sich nicht nur als fatal, er hat - über den Untergang der UdSSR hinaus - Russland bis heute nicht losgelassen. Dass Sieger leer ausgehen, ist nicht nur eine Binsenweisheit: Wer sich für diese komplizierte Problematik interessiert, die auch zum Verständnis der heutigen russischen Politik einiges beiträgt, sollte jedenfalls Jochen Hellbecks "Die Stalingrad-Protokolle" lesen. Eine leichte Kost stellt das Buch allerding nicht dar.
Service
Jochen Hellbeck, "Die Stalingrad-Protokolle. Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht", S. Fischer Verlag
S. Fischer - Die Stalingrad-Protokolle