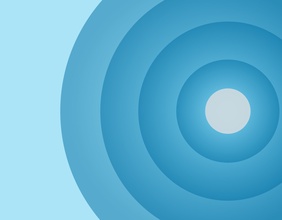"Grande Hotel" in Mosambik
Einst wurde es "Der Stolz von Afrika" genannt: Das Grande Hotel in Beira in Mosambik. Ein Prestigeprojekt des portugiesischen Kolonialregimes: 12.000 Quadratmeter groß, mit 110 Zimmern und Suiten, Kinos, Swimmingpools und Geschäften. Eine Luxusanlage direkt am indischen Ozean.
8. April 2017, 21:58
Doch schon acht Jahre nach seiner Eröffnung musste das Hotel wieder schließen. Nachdem Mosambik 1975 die Unabhängigkeit erlangte, wurde der Keller des Hotels zum Gefängnis für politische Häftlinge, der Rest des Komplexes zur Zentrale von Polizei und Militär. Bis es 1981 schließlich die Bevölkerung an sich riss, und aus dem Gebäude, das weder mit Wasser noch mit Strom versorgt wird, ein kleines Dorf machte. Heute leben in der Ruine des einstigen Grande Hotels 2.000 bis 3.000 Menschen.
In ihrem Dokumentarfilm "Grande Hotel" begleitet die belgische Filmemacherin Lotte Stoops einige der Bewohner durch ihren Alltag. Und zeichnet die wechselhafte Geschichte des Gebäudes nach.
Kulturjournal, 05.04.2013
Als grandioses architektonisches Wunder beschrieb das portugiesische Fernsehen das Grande Hotel bei seiner Eröffnung 1955. Heute ist vom einstigen Prachtbau nur ein graues Skelett geblieben. Mit Teppichen und Betten in Gängen und Nischen, improvisierten Geschäften und Wohnräumen in Zimmern und leeren Hallen.
"Als ich das Grand Hotel zum ersten Mal gesehen habe, war ich total begeistert. Ich dachte mir, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für Social Housing. Die Art, wie hier ein altes Gebäude neu genutzt wird... Aber damals wusste ich noch nicht, dass das einmal ein Hotel war. Und ich wusste auch nicht, dass die Realität nicht so schön war, wie es aus 500 Metern Entfernung am Meer stehend, aussah." Lotte Stoops stieß während eines dreimonatigen Aufenthalts in Beira auf das Grande Hotel, lernte bei Spaziergängen nach und nach die Bewohner und ihre Geschichten kennen. Dabei habe sie vor allem am Anfang Hemmungen gehabt, das Gebäude auch wirklich zu betreten:
"Es hat sich wirklich angefühlt, als würde man in ihre Häuser, in ihre privaten Räume eintreten. Man sieht es ja auch im Film: Durch die Gänge zu spazieren heißt hier gleichzeitig, durch jemandes Schlafzimmer zu gehen. Wenn man dort nicht wirklich etwas zu tun hat, dann fühlt man sich wie ein Eindringling. Erst als ich genau wusste, was ich erzählen will, dass es eine positive Geschichte über diese Menschen und ihre Überlebensstrategien werden sollte, gab ich mir selbst die Erlaubnis, tatsächlich hineinzugehen."
Ein Hotel wie ein Dorf
Wie Gassen ziehen sich die Gänge durch die Ruine. Ein kleiner Marktstand hier, ein improvisierter Friseursalon dort. Der einstige Swimming Pool ist, gefüllt mit Regenwasser, zum Waschraum umfunktioniert, gleich daneben haben sich die Bewohner einen neuen Gebetsraum eingerichtet. Im alten habe es zu viel gezogen, wie einer der Männer stolz erklärt.
"Die Menschen dort sind wirklich gut organisiert", sagt Stoops. "Die könnten problemlos zwei Monate im Grande Hotel bleiben, ohne dieses auch nur einmal zu verlassen. Eigentlich genauso wie früher die Hotelgäste. Es gibt hier alles. Es gibt die kleinen Geschäfte mit Nahrungsmitteln und Getränken, es gibt Friseure, Tischler und natürlich gibt es auch Sex, weil viele Frauen als Prostituierte etwas dazu verdienen. Man kann hier leben, ohne wirklich nach draußen gehen zu müssen."
Stoops begleitet Männer und Frauen jeden Alters durch die Gemäuer. Dazwischen auffallend viele Kinder. Wer die Menschen sind, die hier wohnen? Das könne man so nicht sagen, meint Lotte Stoops: "Fast alles, was es in Mosambik gibt, findet man auch im Grande Hotel. Außer den wirklich reichen und wohlhabenden Menschen natürlich (lacht). Da leben Menschen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, Tischler, Lehrer, Arbeitslose. Aus dem Norden wie aus dem Süden. Das bringt es mit sich, dass auch verschiedenste Religionen zusammenkommen - Christen, wie Moslems, aber auch traditionelle afrikanische Stammesreligionen spielen eine Rolle. Das ist wirklich ein interessanter kleiner Mikrokosmos."
Leben in Gemeinschaft
Doch das bringt auch Probleme mit sich. Am Abend wenn du allein bist, wirst du geschlagen, erzählt eine junge Frau. Wenn du Geld hast, wird es gestohlen, und manchmal werden hier auch Leichen abgelegt. Und wenn in der Umgebung ein Dieb geschnappt wird, dann heiße es immer gleich, der komme aus dem Grande Hotel, beklagt eine andere Frau die Vorurteile gegenüber den Bewohnern.
"Natürlich gibt es Gewalt und Verbrechen", sagt Stoops dazu. "Und ich hätte auch einen komplett anderen Film machen können. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein größeres Problem ist als außerhalb des Hotels. Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber in ganz Mosambik ist das so. Und hier haben die Menschen wenigstens sich selbst. Das ist eine große Gemeinschaft. Und ich glaube, eine solche Gemeinschaft gibt viel mehr Kraft, ermöglicht eine bessere Lebensqualität, wie wenn man mit seinen Problemen alleine ist."
Archivbilder und Schilderungen von einstigen Hotelgästen und Angestellten, die Stoops immer wieder einstreut, wirken dann fast surreal, wenn von prachtvollen Fassaden, von lichtdurchfluteten Hallen, von Casinos und Restaurants die Rede ist. Das Hotel habe nie eine Chance gehabt, profitabel zu sein, glaubt Lotte Stoops, die von kolonialistischem Größenwahn spricht:
"Es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es gab ja nur 100 Gästezimmer! In dieser riesigen Anlage! Man muss sich vorstellen - das sieht man im Film nicht -, aber der Stromgenerator, der damals nur das Hotel versorgt hat, versorgt heute ein ganzes Stadtviertel."
Berührendes Porträt
In Portugal hat Stoops dann ehemalige Angestellte oder auch die Tochter des einstigen Hotelmanagers besucht. Die meisten von ihnen flohen während des Unabhängigkeitskrieges aus Mosambik. Theresa Plantier etwa verbrachte ihre gesamte Kindheit im Hotel, sie habe mit Mosambik ihre Heimat verlassen, in Lissabon habe sie sich dann nie wirklich zu Hause gefühlt, sagt sie.
Lotte Stoops hat ihren Film im Jahr 2010 gedreht, am Ende von "Grande Hotel" heißt es, das Gebäude würde schon bald einem Einkaufszentrum weichen müssen. Doch als die Filmemacherin im vergangenen Jahr zurückkehrte, fand sie alles unverändert vor: "Letztes Jahr bin ich nach Beira zurückgekehrt, um den Film im Grande Hotel zu zeigen. Das war recht abenteuerlich, denn wir haben dafür eine komplette Mauer weiß angemalt, um darauf den Film zu projizieren. Das war dann fast schon gruselig - plötzlich eine Mauer dieses grauen Skeletts in Weiß zu sehen. Jedenfalls stand das Grande Hotel damals noch. Kaum etwas hat sich verändert und ich war sehr überrascht, tatsächlich noch all die Protagonisten meines Films zu treffen. Aber es gibt viele Gerüchte, und es wird das Grande Hotel wohl nicht mehr lange geben. Denn wie in fast allen afrikanischen Staaten: China ist auf dem Vormarsch."
Mit ihrer Dokumentation "Grande Hotel" ist Lotte Stoops ein berührendes Porträt dieser improvisierten Stadt gelungen. Manchmal sind die Spaziergänge durch die einstige Hotelanlage zwar etwas langatmig, doch zugleich birgt hier jeder Raum seine ganz eigene, oft überraschende Geschichte.