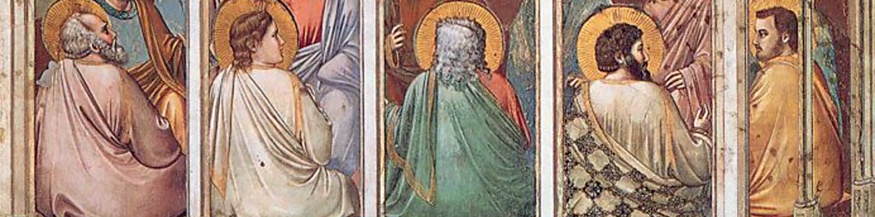298. Inklusionsprojekt Wiener Neudorf
Eine Kultur des Miteinanders in Wiener Neudorf
8. April 2017, 21:58
Inklusion bedeutet mehr als Integration: Statt Menschen bestimmten Kategorien zuzuordnen, geht es um die selbstbestimmte Teilhabe aller und um den Abbau von Barrieren, die diese Teilhabe behindern. In Wiener Neudorf machte sich unter diesem Stichwort eine ganze Gemeinde auf den Weg.
Wie alles begann
Ziele
Projektpartner: Vernetzung im Ort
Erste Aktivitäten
Ergebnisse und Höhepunkte
Was war entscheidend für den Erfolg?
Wie alles begann…
Die Idee kam von zwei LehrerInnen, die einen internationalen Kongress zum Thema „Inklusion“ besuchten. Dabei wurde ihnen bewusst, dass es bereits viele wichtige Aspekte von Inklusion in Wr. Neudorf gab: eine 20-jährige Tradition des gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderungen an der Schule, aber auch in den Kindergärten und in den Horten. Erwachsene mit Behinderungen haben Arbeitsplätze in der Gemeinde bzw. in der Gemeindeverwaltung und auch die Vereine im Ort sind offen für alle Menschen. Bildung und sozialer Zusammenhalt haben in der Gemeinde einen traditionell hohen Stellenwert. Die Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und manchen Vereinen gab es bereits, allerdings punktuell und personenabhängig. Auch Qualität in der Arbeit war allen wichtig, jedoch gab es keine gemeinsame Diskussion über den Qualitäsbegriff. All diese positiven Ansätze sollten nun sichtbar gemacht und gemeinsam in Richtung Inklusion weiterentwickelt werden..
Ziele
Wir wollten eine Kultur der Zusammenarbeit entwickeln nach den Werten von Inklusion – Fairness, Gleichberechtigung, Anerkennung von Vielfalt, Teilhabe, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft – und zwar nicht nur in der Schule, sondern in und mit mit allen Bildungseinrichtungen des Ortes (den Kindergärten, den beiden Horten und der Musikschule) und schließlich mit der gesamten Gemeinde.
Darüber hinaus wollten wir
Stressfreie Übergänge zwischen den Institutionen ermöglichen, z.B. zwischen Kindergarten und Volksschule Ein Netzwerk entwickeln zwischen allen existierenden Institutionen und Vereinen in Wiener Neudorf um die inklusive Entwicklung zu unterstützen .
Eine Kultur der Qualitätssicherung erreichen, indem wir unsere Arbeit immer wieder reflektieren vor dem Hintergrund des „Index für Inklusion“ (link: http://wienerneudorf2.riskommunal.net/system/web/sonderseite.aspx?menuonr"3388938&detailonr"3388938)
Vernetzung im Ort
Teilnehmende Institutionen:
Gemeinde Wiener Neudorf
Rathaus (http://www.wiener-neudorf.gv.at/system/web/abteilung.aspx?menuonr"2568843)
Musikschule
Hans-Stur-Volksschule (VS)
Hort Rathauspark (HR)
Hort Europaplatz
Kindergarten Europaplatz
Kindergarten Reisenbauer-Ring
Kindergarten Rathauspark
Kinderhaus der Volkshilfe
Kindergarten Anningerstraße
Lebenshilfe
PfadfinderInnengruppe Wiener Neudorf
Alle Links zu finden auf http://wienerneudorf2.riskommunal.net/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr"3341648&detailonr"3365958
Erste Aktivitäten
Als erstes formierten wir ein „Index Team“: Je eine Vertreter/in aus jeder Bildungseinrichtung, je eine Elternvertreter/in, Gemeindevertreter, Expert/innen, Berater/innen, wissenschaftliche Begleitung (durch die PH Niederösterreich) und wir tagen seither in regelmäßigen Abständen und koordinieren die Aktivitäten.
Am 24. Mai 2006 fand unsere Auftaktveranstaltung statt. Eltern und Interessierte konnten sich informieren und die Kinder bauten ein Riesenmobile mit Unterstützung der Vereine
Im Juni 2006 fand eine Ist-Stands Erhebung nach den Kriterien des „Index für Inklusion“ statt. 1400 Personen – Eltern, alle Lehrpersonen, KindergärtnerInnen, HorterzieherInnen und die Kinder ab dem 5. Lebensjahr – sollten die Stärken und Schwachstellen bezüglich des Zusammenlebens, der Möglichkeiten der Teilhabe und der gegenseitigen Unterstützung und Wertschätzung aufzeigen.
Die Aussage „Es herrscht eine Atmosphäre, wo sich jede/r willkommen fühlt“ erhielt große Zustimmung. Als „Baustellen“, wo noch Bedarf an Weiterentwicklung besteht, stellten sich die Bereiche „Kommunikation“ und „Konfliktmanagement“ heraus.
Die Ergebnisse wurden allen rückgemeldet und waren die Diskussionsgrundlage für weitere Aktivitäten. Eine geeignete Rückmeldungsform für die Kinder zu finden erforderte Kreativität. Studierende der PH Niederösterreich leiteten die Diskussionen in den Schulklassen. Die Kinder sammelten Ideen, wie die Schwachstellen verändert werden könnten, diskutierten, schrieben Texte oder zeichneten ihre Vorschläge auf Plakate. Erst dann wurde der/die Klassenlehrer/in hereingebeten und die Kinder teilten ihnen ihre Entwicklungsideen mit.
Ergebnisse und Höhepunkte
Eine Reihe von institutionalisierten Kooperationen ist entstanden:
Das Index Team bestand anfangs aus Vertreter/innen der Bildungseinrichtungen, der Eltern sowie dem Vizebürgermeister und einem Gemeiderat als Gemeindevertreter. Die ersten drei Jahre unterstützten uns auch Expert/innen aus der PH Niederösterreich. Sie begleiteten unser Projekt im Rahmen einer formativen Evauation. Schritt für Schritt kamen weitere Menschen dazu: aus der Gemeindeverwaltung, den Vereinen, Senior/innen vom Generationendialog.
und andere Interessierte. Jetzt sind wir etwa 20 Personen, die sich alle sechs Wochen treffen. Die Arbeit ist ehrenamtlich und nicht alle können es sich jedes Mal leisten, dabei zu sein, aber wir sind immer genügend viele um den Prozess voranzubringen.
Die Schulgemeinschaftskonferenz besteht aus allen mit Schule befassten Gruppen – von den Klassensprecher/innen bis zum Bürgermeister. Hier fand im Herbst 2006 die Rückmeldung zur ersten Befragung statt – für Schulpersonal, Elternvertreter/innen, Bürgermeister und Vizebürgermeister. Dies brachte viel an gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung für die jeweilige Arbeit. Im Rahmen dieser Konferenz wurden auch erste Arbeitsgruppen gebildet mit dem Ziel, die „Baustellen“ aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Eine dieser Arbeitsgruppen ist die Demokratiegruppe für die Kinder, das Kinderparlament. Auch das Schulleitbild wurde im Rahmen einer Schulgemeinschaftskonferenz gemeinsam erstellt und „der rote Faden des Zusammenlebens“ - Verhaltensvereinbarungen unter Berücksichtigung inklusiver Werthaltungen.
Das Kinderparlament: VertreterInnen aller Klassen, inklusive Vorschule, LehrerInnen, Direktorin und ElternvertreterInnen behandeln hier Themen, die den Kindern an der Schule wichtig sind. Die Ergebnisse werden im Klassenrat an die MitschülerInnen weitergegeben und diskutiert.
O-Ton:
Sarah, Vorschulklasse: „Ich find gut, dass man spricht, wie man sich in der Schule wohl fühlt und was man sich wünscht.“ Patricia, 3. Klasse: „Mir macht das Spaß. Da erfährt man Sachen über die Schule. Das kann man in der Klasse besprechen, dass alle sich an die Regeln halten, damit alle sich gut verstehen.“ Diese Gruppe kann auch schon auf große Erfolge verweisen: Sie bereitete ein mit allen SchülerInnen abgestimmtes Schulgartenkonzept vor, das sowohl im extra einberufenen Schulgemeinderat als dann auch in der Gemeinderatssitzung angenommen und bereits verwirklicht wurde, es unterstützte die Architekten bei der Planung des Schulumbaus mit einer Sammlung an Bedürfnissen der Schüler/innen für eine gute, den Lernprozess förderliche Lernumgebung oder handelte mit den Schulwarten eine Lösung für ansprechende WC-Anlagen aus. Im letzten Jahr erarbeitete sie u.a. Vorstellungen zum Leben in Wiener Neudorf als Beitrag zur Leitbildentwicklung „Wiener Neudorf 2030“.
Vernetzungsgruppe Schule – Kindergarten:
Im Rahmen der Vernetzung aller pädagogischen Einrichtungen in Wiener Neudorf entwickelte sich im Herbst 2007 die Idee einer Lesepartnerschaft zwischen der Volksschule und den Kindergärten des Ortes. Diese sorgt durch Vertrauensaufbau bei Kindern und Eltern für Entschärfung der Nahtstelle Kindergarten – Schule und dient der Sprachschulung und der Freude an Büchern.
O-Ton:
Christina (Kindergartenkind): „Ich finde das Vorlesen lustig. Es hat mir gefallen mich an meine Lesepartnerin anzukuscheln. Alle Schulkinder haben schön vorgelesen.“ Johanna (Schulkind): „Ich finde das Vorlesen schön und es gefällt mir, dass die Kindergartenkinder so toll zuhören. Die Kinder sind richtig anhänglich und ich würde gerne noch einmal vorlesen.“ Eine Reihe weiterer größerer und kleinere Maßnahmen folgten, um den Übergang möglichst zu konstruktiv zu gestalten: eine Elternschule mit drei Veranstaltungen im Kindergarten und drei im ersten Schuljahr, gemeinsame Elternabende im Kindergarten, Schnuppertage in der Schule u.a.m.
Vernetzungsgruppe Schule – Hort
Die Gruppe aus HortpädagogInnen und LehrerInnen trifft sich viermal im Jahr und bemüht sich, die Kommunikation zwischen Schule und Hort zu verbessern. Es werden Ideen, Anregungen und Wünsche ausgetauscht. Ergebnisse sind u.a. ein gemeinsames Mitteilungsheft Schule-Hort, Round Table-Gespräche mit allen Beteiligten sowie zweimal jährlich – mit Erlaubnis der Etern - gemeinsame pädagogischeKonferenzen der Schul- und Hortpädagog/innen zum Austausch von Organisatorischem aber auch von inhaltlichen Fragen und Unterstützungsmöglichkeiten.
Dialog der Generationen
SeniorInnen werden in die Arbeit im Kindergarten, in der Schule und im Hort eingebunden. Sie haben oft das Bedürfnis nach Sinn stiftender Tätigkeit, wollen ihre persönlichen Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben und interessieren sich umgekehrt für die Fragen der Kinder. Dabei steht die Förderung der Beziehung zwischen den Generationen und die Bereicherung des Unterrichts im Vordergrund, nicht der schulische Aspekt oder die Entlastung der PädagogInnen.
O-Ton: „Ich möchte die Lesetage im Kinderhaus Kunterbunt nicht mehr missen“ (Friedrich Csörgits, Leseopa)
Temporäre Arbeitsgruppen:
In der Zukunftskonferenz des Indexteams, die im November 2012 stattfand, wurden Schwerpunkte für 2013 gesetzt.
Eine Arbeitsgruppe arbeitet unter dem Arbeitstitel „Windelrocker“ zum Thema Familienzentrum. Die ersten Schritte sind eine Bestandsaufnahme, was gibt es schon im Ort an Unterstützungsmöglichkeiten für Familien, was braucht mehr Vernetzung, welche Ressourcen können noch gefunden werden,....
eine weitere Arbeitsgruppe arbeitet an Bücherkisten für verschiedene Plätze in der Gemeinde.
Was war entscheidend für den Erfolg?
Der Index für Inklusion – in seinen unterschiedlichen Versionen für Schule, Kindergarten und Horte sowie für Kommunen - ist das wichtigste Instrument für unsere Kooperation. (Er ist sowohl Leitlinie für uns wie auch ein Instrument zur Selbstevaluation).
Seminare und Coaching zum Thema „gewaltfreie Kommunikation“ nach M.B. Rosenberg (finanziert durch die Gemeinde): Die Kurse fanden in gemischten Gruppen statt: HochschulprofessorInnen, Assistenzpersonal, PädagogInnen und Eltern saßen bunt gemischt durcheinander und lernten an gemeinsamen Inhalten. Die Erkenntnis: Wenn auch die Art und Weise, etwas auszudrücken, manchmal unterschiedlich ist, sind die dahinter stehenden Anliegen und Bedürfnisse doch sehr ähnlich. Um die Kinder einzubeziehen wurde gemeinsam „Mitmachtheater“ gespielt: Die Kinder erarbeiteten unter fachlicher Anleitung ein Theaterstück, um alle für das Thema „gewaltfreie Kommunikation“ zu sensibilisieren.
Das Institutionalisieren von Kooperationsmöglichkeiten (siehe oben) Der Hochschullehrgang „Kommunale Bildung“: Bildung findet „Stadt“. Die PH Niederösterreich erstellte das Curriculum basierend auf den Themenbereichen, die in einem Workshop mit den BürgerInnen von Wiener Neudorf erarbeitet wurden. Er war offen für alle Menschen, ohne jegliche Zugangsvoraussetzungen außer der Freude am gemeinsamen Forschen und Lernen. So waren z.B. auch Personen mit Lernbeeinträchtigung vom Verein „Lebenshilfe“ unter den Lehrgangsteilnehmer/innen.
Kurzfilm: http://www.ph-noe.ac.at/uploads/media/Staatspreis_.wmv
Kräftig zu feiern! - z.B. das „Kick Off Festival“, das „Inklusionsfest“ nach 3 Jahren Inklusion oder das „Fest der offenen Töpfe“ (Festival of Open Pots), das die vielfältigen Wurzeln der Wiener Neudorfer Bürger/innen sichtbar machen soll.
Inklusive Werte mit Leben füllen durch eine breite Diskussion über die Umsetzung einer inklusiven Haltung in allen Bereichen des Lebensalltags. Konferenzen und andere Zusammenkünfte (z.B. auch die unlängst eröffnete inklusive Nähschule) beginnen häufig mit einer Frage aus dem Index und auf der Homepage der Gemeinde gibt es die „Frage der Woche“ mit mehreren Abstimmungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse aller Fragen können jederzeit abgerufen und eingesehen werden. Sie fließen in die Gemeindepolitik ein.
Die Netzwerkbildung über Comenius-Projekte zum Austausch, Denkanstoß sowie zur Schärfung und Erweiterung des Blickwinkels. Von 2010 bis 2012 entstand über ein Comenius-Regio-Projekt eine intensive, alle Seiten bereichernde Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Bonn, die auch über das Projektende hinaus aufrecht ist. Von 2011 bis 2014 ist Wiener Neudorf Referenzgemeinde im Comenius Network CoDeS (Collaboration of schools and communities for sustainable development), in dem Expert/innen aus 15 europäischen Staaten zusammenarbeiten, um Wege zur Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Kommunen aufzuzeigen. Ziel ist die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung. (Projekthomepage: http://www.comenius-codes.eu) Besucher/innen aus dem In- und Ausland tragen als „critcal friends“ mit ihren Rückmeldungen zur Weiterentwicklung bei.
Das Projekt wurde von der Unesco ausgezeichnet und Wiener Neudorf ist berechtigt die Auszeichung für die Decade zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 2014 zu tragen.
Eingereicht von
Angela Gredler
Link
Übersicht
- Innovation.Leben - Siegerprojekte