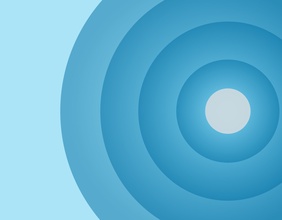Sören Kierkegaard neu aufgelegt
Tagebuch des Verführers
Eigentlich ist das "Tagebuch" Teil eines viel größeren Textkörpers: Kierkegaards "Entweder - Oder" erschien 1843 und sein Erstlingswerk über Ethik und Ästhetik wurde ob seines Umfangs - über 800 Seiten - "Monstrum von einem Buch" genannt.
8. April 2017, 21:58
Am Schluss des ersten Teils befindet sich dann das "Tagebuch des Verführers", es ist sozusagen das literarisch-praktische Beispiel für den philosophischen Überbau. Heute liest man "Das Tagebuch des Verführers" als eigenständigen Text, der nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Du bist mein, ich bin Dein
Zitat
Nicht nenne ich Dich mein, denn ich begreife wohl, dass Du es nie gewesen bist, und ich bin hart genug dafür gestraft, dass dieser Gedanke meine Seele einmal erfreut hat - und doch nenne ich Dich mein: mein Verführer, mein Betrüger, mein Feind, mein Mörder, Ursache meine Unglücks, Grab meiner Freude, Abgrund meiner Unseligkeit. Ich nenne Dich mein und nenne mich Dein, und wie es Deinem Ohr einmal geschmeichelt hat, so soll es nun wie ein Fluch über Dich klingen, ein Fluch in alle Ewigkeit. Du hast Dich vermessen, einen Menschen so zu betrügen, dass Du mir alles geworden bist, dass ich all meine Freude daransetzen würde, um Deine Sklavin zu sein, Dein bin ich, Dein, Dein Fluch.
Wer Sören Kierkegaards "Tagebuch des Verführers" zu Ende gelesen hat, nun an den Anfang des Buches zurückkehrt und diese Briefzeilen nochmals liest, der mag denken: Armes Mädchen, wärest Du nur nie dem "Verführer" begegnet, diesem Monster von Mann! Allein das "Tagebuch des Verführers" ist ein vielschichtiges Gewebe - in literarischer, philosophischer, psychologischer und autobiografischer Weise.
Weibliche Unschuld als Antriebsmotor
Zitat
Ich suche meine Beute stets unter jungen Mädchen, nie unter jungen Frauen. Eine Frau hat weniger Natur und mehr Koketterie, die Beziehung zu ihr ist nicht schön, nicht interessant, sondern pikant, und das Pikante ist immer das Letzte.
Johannes nennt sich der "Verführer" in seinen Tagebuchaufzeichnungen. Er macht aus seiner Passion kein Hehl, begründet sie, aus einem ästhetischen Trieb heraus. Das Brechen der weiblichen Unschuld ist sein Ziel, ganz jung müssen die Frauen sein, denn bei ihnen zeigt sich die erotisch-sinnliche Hingabe quasi im Urzustand.
Und sein nächstes Opfer hat er schon ins Visier genommen: Cordelia heißt sie, sie ist blutjung, bezaubernd schön, stammt aus sittsamen Kopenhagener Verhältnissen. Was nun dieser Johannes alles strategisch unternimmt, um seine Cordelia einzufangen, ist dann tatsächlich ein perfides Meisterstück der Verführung.
Er macht sich etwa zum Freund eines jungen Mannes, der Cordelia tatsächlich liebt und sie ehelichen möchte. Da der junge Mann etwas tölpelhaft und schüchtern ist, hilft ihm Johannes anscheinend auf die Sprünge. In Wahrheit führt er Cordelia einen Dummkopf von Mann vor, bis diese Johannes als den einzig Richtigen ansieht. Jedes Treffen, jede Geste, jede Berührung ist ab nun eine Inszenierung des Verführers, des Regisseurs dieser Liebes(ent)täuschung. Dabei argumentiert Johannes dialektisch perfide, gerade so als sei er ein Adept der Dialektik Hegels (die Kierkegaard rundweg ablehnte). So schreibt er an Cordelia einen argumentativ logischen Liebesbrief.
Selbstverliebt
Zitat
Verliebt bin ich in mich selbst - warum? Weil ich verliebt bin in Dich, denn Dich liebe ich, Dich allein und alles, was zu Dir gehört in Wahrheit, und so liebe ich mich selbst, weil dieses mein Ich zu Dir gehört, und hörte ich auf Dich zu lieben, so würde ich aufhören, mich selbst zu lieben.
Hier wird logisch richtig geschlossen, aber mit Worten falsch geschossen. Denn das "Ich liebe Dich" ist erlogene Einbildung zum Zwecke der Verführung. Nach Abschluss des Briefes an Cordelia notiert Johannes für sich:
Zitat
Am meisten habe ich befürchtet, die ganze Entwicklung würde mich zu viel Zeit kosten. Ich sehe indessen, dass Cordelia große Fortschritte macht, ja dass alles in Bewegung gesetzt werden muss, um sie recht in Atem zu halten. Sie darf um alles in der Welt nicht vor der Zeit ermüden, das heißt vor jener Zeit, da ihre Zeit vorüber ist.
Cordelia willigt alsbald in die Verlobung ein. Und Johannes gelingt das fast Unvorstellbare: Nicht er wird diese Verlobung lösen, sondern Cordelia selbst, indem sie durch die argumentativen Einflüsterungen Johannes' erkennt, dass er eben doch nicht der Richtige ist. Den Abschluss bildet der sexuelle Vollzug. Damit ist für Johannes die Verführung beendet. Der paradiesische Apfel der Eva ist wurmstichig geworden.
Unfähig zur Hingabe
Mit all dem könnte Sören Kierkegaards "Tagebuch des Verführers" sein Ende finden, wenn nicht beim Lesen Zweifel aufkämen, die am coolen Image des Mannes kratzen. Indem Johannes in extremer Weise Liebe vorspielt, spielt er sich selbst in die Liebe hinein - nämlich in die unschuldige Liebe des Mädchens Cordelia.
Sie ist die anderer Seite der Verführung, ein Spiegel, der Johannes tiefenpsychologisch Dreifaches vor Augen führt: Er ist liebesunfähig, weil er Angst vor der Hingabe hat. Und er hat Angst vor der Hingabe, weil sie ins Religiöse abzugleiten droht: Die blutjunge, unschuldige Cordelia soll in Wahrheit eine unerreichbare Madonna sein. Doch wer gottgleiche Liebe im Leben anstrebt, ist der nicht ein Ketzer an der Liebe Gottes? Johannes verfolgt diesen Gedankengang mehrfach im "Tagebuch", es kommt zu einem Hin und Her zwischen betrügerischer Verführung und Hingabe. Dies deswegen, "weil meine ganze Seele von Dir voll ist, bekommt das Leben für mich eine andere Bedeutung, es wird Mythos von Dir".
Dieser "Mythos" einer überhöhten Liebe wird letztlich für Johannes zum "Fluch" - so wie es Cordelia in ihrem Brief dargelegt hat.
Zitat
Mag Gott den Himmel behalten, wenn ich nur sie behalten darf. Ich weiß wohl, was ich wähle, es ist so groß, dass dem Himmel selbst mit einer solchen Teilung nicht gedient sein kann - denn was bliebe ihm, wenn ich sie behielte?
Sich "Herausdichten"
Der Fluch, der auf den Verführer lastet, ist sein Anspruch: Er verführt das Mädchen Cordelia - und damit raubt er ihr die Unschuld. Ein gottgleicher Verführer wäre er, wenn er sie behielte als reines, in ihrer Unschuld erstrahlendes Mädchen - als Madonna! Kierkegaard und sein Verführer wissen das. Um diesem Fluch zu entkommen, wird im "Tagebuch" ein frommer Wunsch notiert:
Zitat
Sich in ein Mädchen hineinzudichten ist eine Kunst, sich aus einem Mädchen herauszudichten ist ein Meisterstück.
Diese Überlegung führt direkt in Sören Kierkegaards vertracktes Liebesleben. Auch er freite in jungen Jahren das bildhübsche Mädchen Regine Olsen - und löste die Verlobung alsbald. Verfallen blieb er ihr ein Leben lang - das "Herausdichten" misslang also! Und sie, längst verheiratet und dann Witwe, vermarktete sich als "ewige Braut" Kierkegaards. Sie gab Interviews, besuchte sein Grab, genoss den späten Ruhm. Und dieses seltsame Liebesverhältnis ist natürlich eine "Parallelaktion" zu Kierkegaards "Tagebuch des Verführers".
Die einzige Liebe
Nachzulesen ist das alles in Joakim Garffs wunderbarer, klug und vergnüglich geschriebener Kierkegaard-Biografie.
Sören Kierkegaard lernte Regine Olsen erstmals 1837 kennen, damals war sie gerade vierzehn Jahre alt. Drei Jahre später waren beide miteinander verlobt. Den gefühlsmäßigen Überschwang findet man sowohl in den Briefen als auch im "Tagebuch" wieder. Der verliebte Kierkegaard schreibt an seine Verlobte Folgendes:
Zitat
Du sitzt im Sofa, die Gedanken schweifen weit umher, das Auge wird von nichts gehalten, allein in der Unendlichkeit des weiten Himmels schwinden die unendlichen Gedanken hin, alles, was dazwischen liegt, ist nicht mehr da, es ist, als ob Du segelst in den Lüften.
Im "Tagebuch des Verführers" klingt das ein wenig prosaischer. Und das muss es ja auch, weil Johannes ein perfides Spiel mit Cordelia betreiben möchte.
Zitat
Sie sitzt auf dem Sofa am Teetisch, ich auf einem Stuhl an ihrer Seite. Eine verklärende Feierlichkeit erfüllt die Situation, ein sanftes Morgenlicht. Sie schweigt, nichts unterbricht die Stille. Sacht gleitet mein Auge über sie hin, nicht begehrend, dazu gehört wahrhaft Frechheit.
Madonnenhafte Liebe
Aber war das Verlobungs- und Entlobungsspiel, das Kierkegaard mit Regine Olsen trieb, nicht letztlich auch perfide, ja, eine "Frechheit"? Die Familien der beiden Verlobten sahen es zumindest so, wohl auch ein Gutteil der Kopenhagener besseren Gesellschaft. Doch Regine, die eine Zeit lang wie eine Löwin um die Liebe ihres Verlobten kämpfte, ja, sogar anbot, bloß in einem kleinen Schrank zu hausen, um bei ihm bleiben zu dürfen, gewann am Schluss ihre Würde zurück. Der Biograph Joakim Garff schildert die Szene so:
Zitat
Kierkegaard hat am Seitenrand neben jener Stelle, wo er in "Barmherziger Gott" ausbricht, hinzugefügt, dass Regine auf ihrer "Brust" einen "kleinen Zettel, auf dem ein Wort von mir stand", zu tragen pflegte. Was da stand, weiß keiner mehr, Regine zog nämlich den kleinen Zettel hervor und riss ihn langsam in kleine Stücke, starrte vor sich hin und sagte leise: "So hast du doch ein schreckliches Spiel mit mir getrieben." Diese kleine Geste ist eine entscheidende Aktion: Regine macht sich von der Schrift frei und kehrt in die Wirklichkeit zurück. Selbst erinnert sie sich, dass sie beim letzten Abschied sagte: "Jetzt kann ich nicht mehr; küss mich noch einmal und sei dann frei."
Kierkegaard löste die Verbindung zu Regine Olsen aus mehreren Gründen: Auch er hatte Angst vor der Hingabe und Angst davor, nicht mehr unabhängig schreiben und leben zu können. Doch eben auch das religiöse Motiv spielt mit hinein. Wie sein "Verführer" Johannes überhöhte Kierkegaard seine Liebe zu Regine ins Religiöse, Madonnenhafte. Und das war ihm eben nicht geheuer! Sein Biograf notiert dazu:
Zitat
Kierkegaard war also schon im voraus Gott angetraut. Nahezu blasphemisch kann das Bild wirken und vermag nur oberflächlich die menschliche Ohnmacht zu verbergen, welcher sie entwachsen ist.
Als eine sichtbare Mahnung an das fatale Vergessen ließ Kiekrgeaard seinen Verlobungsring so umschmelzen, dass die Steine ein Kreuz bildeten.
Regines Reaktion war ganz einfach, dass sie im Laufe ganz kurzer Zeit graue Haare bekam.
Kierkegaards an Kant angelehnter Imperativ "Du sollst lieben" umfasst Mensch wie Gott. Doch im Angesicht des Todes ist die irdische Liebe ein "Scherz". Ist sie es aber nicht und wird ins Madonnenhafte überhöht, dann ist sie Blasphemie! So sah es Sören Kierkegaard. Lieben wollte er bedingungslos - die Frauen, das Leben und Gott. Das ist ihm gründlich missglückt. Doch geblieben ist der Mensch, der existenzielle Querdenker, religiöse Dandy und Autor, dessen Schriften an Strahlkraft nichts eingebüßt haben.
Service
Sören Kierkegaard, "Tagebuch des Verführers", aus dem Dänischen übersetzt von Gisela Perlet, Manesse
Joakim Garff, "Sören Kierkegaard. Biographie", aus dem Dänischen übersetzt von Herbert Zeichner und Hermann Schmid, Carl Hanser
Übersicht
- Philosophie