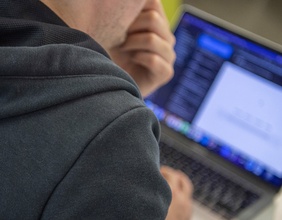Sabine Ladstätter zum Abenteuer Archäologie
Knochen, Steine, Scherben
Abenteuer Archäologie: Viele denken da zum Beispiel an den schneidigen Hollywood-Archäologen Indiana Jones oder auch an den Grusel-Schocker „Die Mumie“. Mit dem, was real auf den Grabungen dieser Welt passiert, hat das, was das Unterhaltungskino durch die Jahrzehnte hindurch auf die Leinwände gezaubert hat, natürlich nicht das Geringste zu tun.
8. April 2017, 21:58
In ihrem Buch „Knochen, Steine, Scherben“ zeigt die Archäologin Sabine Ladstätter, wie es sich wirklich gestaltet, das Handwerk der Archäologie.
Seit 2010 leitet die gebürtige Kärtnerin das Prestigeprojet der österreichischen Feldarchäologie, die Ausgrabungen in Ephesos. In griechischer Zeit beherbergte Ephesos mit dem berühmten Tempel der Artemis eines der sieben Weltwunder, in der römischen Periode ab 133 vor Christus stieg die kleinasiatische Metropole – mit etwa 200.000 Einwohnern – zu einer der bedeutendsten Städte des römischen Reichs auf.
Geschichte der Archäologie
„Also, Ephesos war nicht nur eine der größten römischen Städte, sondern sicher auch eine der bedeutungsvollsten, sowohl in wirtschaftlicher, in politischer aber auch in kultureller Hinsicht“, sagt Sabine Ladstätter.
Auf ihre ganz konkrete Arbeit in Ephesos geht Sabine Ladstätter in ihrem Buch nur am Rande ein. „Knochen, Steine, Scherben“ bietet grundsätzlichere Einblicke in die archäologische Wissenschaft. Zunächst zeichnet die Leiterin der Ephesos-Ausgrabungen einen Grundriss der Geschichte der Archäologie. Dabei geht Ladstätter erfrischend kritisch ans Werk. Die heroischen Jahre der Archäologie kann man im 19. Jahrhundert verorten. Ladstätter hält fest:
Zitat
All diese Aktivitäten im 19. Jahrhundert waren stark politisch motiviert.(...) Mit dem Erstarken des Nationalismus setzte ein wahrer Wettstreit um die besten, das heißt prestigeträchtigsten und kulturhistorisch bedeutendsten archäologischen Ausgrabungen ein. Das besondere Interesse Europas galt den reichen Ruinenstätten im Osmanischen Reich, in dessen Territorium nun zahlreiche Ausgrabungen initiiert wurden. Die daraus gewonnenen neuen Erkenntnisse flossen direkt in die universitäre Lehre und Forschung ein und trugen damit maßgeblich zur Entwicklung der Feldarchäologie als akademische Disziplin bei. Ein weiteres Ziel war, die Sammlungen in den europäischen Museen – in Berlin, London, Paris und auch in Wien – mit besonderen Fundstücken und Kunstwerken aus den eigenen Grabungen zu bereichern.
Es war der kulturimperialistische Geist eines aggressiven Eurozentrismus, der in der Archäologie des 19. Jahrhunderts waltete, kritisiert Ladstätter. Später spielten auch andere Ideologismen eine Rolle. Ladstätter schreibt:
Zitat
Die archäologische Forschung des 20. Jahrhunderts wurde entscheidend vom Sozialdarwinismus mitgeprägt. Das Grundprinzip vom Überleben des Stärkeren wurde auf Kulturen, Völker und Nationen übertragen; darauf aufbauend wurden Blütezeit und Dekadenz, Aufbau und Zerstörung einander gegenübergestellt. Die Archäologie eignete sich hervorragend zur Unterstützung und Bestätigung dieser Ansichten.
Mit solchen Tendenzen hat die heutige Archäologie, die ihr Handeln im Idealfall selbstkritisch hinterfragt, nichts mehr zu tun. Man agiert behutsamer, reflektierter, ideologisch zurückhaltender. Sabine Ladstätter wendet sich mit ihrem Buch an ein populärwissenschaftlich interessiertes Publikum, ohne die Dinge „disneylandisierend“ zu vereinfachen. Dennoch vermittelt die Direktorin des „Österreichischen Archäologischen Instituts“ ein lebendiges Bild des antiken Alltags.
Die Authentizität des Unrats
"Zur Lebenserwartung im römischen Reich haben wir in Ephesos neueste Ergebnisse. Unsere anthropologischen Analysen haben ergeben, dass die Menschen im Durchschnitt zwischen 35 und 45 Jahre alt wurden, wobei adulte Frauen um etwa fünf Jahre älter wurden als die Männer", sagt die Autorin. Woher weiß die moderne Archäologie das alles? Nun, nicht zuletzt von besonders ergiebigen Grabungsschauplätzen her, aus der Auswertung antiker Müllhalden:
Zitat
Antike Abfallgruben auszugraben gehört zu den faszinierendsten Erlebnissen eines Archäologen, da sich gerade im Müll das tägliche Leben abbildet. Hier findet man zerbrochenen und nicht mehr verwendbaren Hausrat, Speiseabfälle, Fäkalien und unter besonderen Erhaltungsbedingungen auch Gegenstände aus organischen Materialien wie Korbwaren, Holzbesteck und Kleidungsreste. Die Müllhalde ist im Gegensatz zum Kunstwerk nichts intentionell Geschaffenes, sondern in ihrer Zusammensetzung ein Zufallsprodukt. Hier spielen Selbstdarstellung, Repräsentation, Wirkung und Rezeption keine Rolle. Die Abfallgrube will mit niemandem kommunizieren und vermittelt keine Programmatik. Es handelt sich schlicht um ein authentisches Abbild des Alltagslebens.
Kult und Glaube
Die römische Kultur war polyethnisch und polytheistisch bestimmt; eine solche Kultur war natürlich geprägt vom Nebeneinander verschiedenster Kulte und Religionen. An die Zelebritäten des römischen Götterhimmels – Jupiter und Juno, Neptun, Mars und Minerva – hat der durchschnittliche Römer ohnedies nicht geglaubt, erklärt Sabine Ladstätter, zumindest nicht in dem Sinn, in dem ein frommer Muslim heute an Allah, eine gläubige Katholikin an die heilige Dreifaltigkeit glaubt. Einerseits gab es die offiziellen Kulte, andererseits den Herrscherkult: "Die römischen Kaiser wurden göttlich verehrt und man hatte ihnen zu opfern, aber man hat nicht an sie geglaubt", sagt Ladstätter.
Neben der klassischen Staatsreligion blühten und gediehen im römischen Reich alle Arten von Sekten und Mysterienreligionen, der Mithraskult, aber auch andere Geheimkulte. Eine besonders interessante Figur, die als magisch galt und verehrt wurde, sei Abraxas, so Ladstätter. "Sie hat einen menschlichen Rumpf, zwei schlangenartige Füße und das Haupt eines Hahnes. Man hat sich kleine Gemmen mit seiner Darstellung in die Gewänder eingenäht und bei sich getragen." Die Wirkung dieser Figur ist heute noch im Wort "Abrakadabra", das sich von ihr ableitet, ersichtlich, erzählt die Forscherin.
Die klassische Grabungsarchäologie war bis in die 1990er und 2000er Jahre hinein eine so gut wie uneinnehmbare Männerdomäne. Das beginnt sich zu ändern. Sabine Ladstätter – eine der Pionierinnen dieser Entwicklung – bietet mit „Knochen, Steine, Scherben“ eine informative Einführung in ihr Fachgebiet: kompetent, informativ und gut zu lesen.
Service
Sabine Ladstätter: „Knochen, Steine, Scherben – Abenteuer Archäologie“, Residenz-Verlag