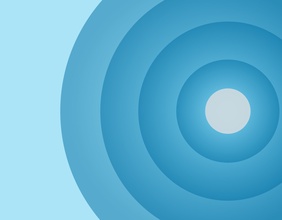Max Weber, Theoretiker des 20. Jahrhunderts
Wie Sigmund Freud, wie Ludwig Wittgenstein oder Bertrand Russell gilt er als einer der bedeutendsten Groß-Theoretiker des 20. Jahrhunderts, man feiert ihn als Bahnbrecher auf den verschiedensten Forschungsfeldern - von der Nationalökonomie bis zur Religionswissenschaft: Der Soziologe Max Weber wäre am 21. April 150 Jahre alt geworden.
8. April 2017, 21:58
Aus diesem Anlass erscheinen gleich zwei opulente Biografien über den "wilhelminischen Modernisten", der mit seiner Schrift über "Die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus" eine der großen, kanonischen Erzählungen der Moderne geschaffen hat.
Kulturjournal, 16.04.2014
Siebzehn Jahre - eine lange Zeit: Siebzehn Jahre Arbeit hat der in Marburg lehrende Soziologe Dirk Kaesler in seine 1000-seitige Max-Weber-Biografie investiert, soeben bei C. H. Beck erschienen. Dabei musste der 70-jährige - auf Insistieren des Verlags - noch um einige hundert Seiten kürzen, ursprünglich war Kaeslers Manuskript noch um einiges voluminöser.
"Max Weber ist bis zum heutigen Tag eine eminente Anregungsmaschine in begrifflicher, wissenschaftlicher, aber auch menschlicher Hinsicht", meint Dirk Kaesler.
Max Weber, so könnte man sagen, ist Kaeslers intellektueller Lebensmensch. Akribisch und mit weit ausholendem Gestus lässt der Marburger Soziologe in seiner Biografie das Leben des wilhelminischen Modernisten Revue passieren.
Ein kränkliches Kind
Max Weber, Jahrgang 1864, entstammt einer angesehenen preußischen Familie: Sein Vater saß als Abgeordneter der Nationalliberalen im deutschen Reichstag, Mutter Helene, eine fromme Protestantin, engagierte sich in der Armenfürsorge. Weber, ein kränkliches Kind, wächst zu einem wuchtigen Neurotiker von vielerlei Talenten und genialischem Habitus heran. In den 1880er Jahren studiert er Nationalökonomie und Jura, 1893 heiratet er die spätere Soziologin und Frauenrechtlerin Marianne Schnitger. Ein Jahr später tritt Weber seine erste Professur in Freiburg im Breisgau an, als Nationalökonom.
Marianne und Max führen eine kinderlose und eine ganz und gar asexuelle Ehe. Weber versucht, die vorhandenen erotischen Defizite durch manischen Arbeitseifer zu kompensieren. Er stürzt sich in die wissenschaftliche Arbeit - ein Worcaholic.
"Max Weber hat versucht, alle gegensätzlichen Tendenzen der modernen Zeit in seinem Leben zu vereinbaren", meint Jürgen Kaube. "Leidenschaft, Rationalität, Zerrissenheit, Nähe zum Wahnsinn, höchste Vernunft, das ist ein Leben, das im Exzess gelebt wurde", diagnostiziert der "FAZ"-Journalist Jürgen Kaube. Mit seiner vergleichsweise kompakten Weber-Biografie - sie umfasst schlanke 500 Seiten - war Kaube in diesem Frühjahr für den Leipziger Buchpreis nominiert. Kaube nähert sich dem soziologischen Titanen auf eher essayistische Weise, er schlägt Schneisen der Übersichtlichkeit in den Dschungel des Weberschen Lebens und Denkens.
Stammvater der wertfreien Wissenschaft
Seine ganze Strahlkraft hat der Theoretiker Max Weber erst Jahrzehnte nach seinem Tod entfaltet. Aber was für einen Stellenwert hat dieser Mann heute! Max Weber gilt als Stammvater der wertfreien Wissenschaft, als Heros des akademischen Liberalismus', als einer der ersten - und zugleich letzten - Monumental-Theoretiker der bürgerlichen Soziologie, wobei vor allem Webers Schrift über die "protestantische Ethik" die Gemüter bis heute erhitzt.
Dirk Kaesler erklärt, worum es geht: "Die Weber-These in der verkürzten, simplifizierten Form heißt: Ohne den Protestantismus wäre es nicht zum Kapitalismus gekommen. Und das kann man dann rekonstruieren als eine Verantwortung. Also der Protestantismus ist schuld am modernen, rationalen Betriebskapitalismus." Eine Hypothese, die inzwischen angezweifelt wird.
Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus
Jürgen Kaube weist darauf hin, dass man es auch umgekehrt sehen könnte. Vielleicht waren zuerst die geschäftstüchtigen Kaufleute da, und die waren dann eben besonders anfällig für die asketischen, auf rationale Lebensführung ausgerichteten Ideale des Protestantismus.
"Vielleicht war es so: Kaufleute waren Protestanten, und nicht Protestanten wurden Kaufleute", sagt Jürgen Kaube. "Ein wichtiger Einwand oder eine wichtige Rückfrage an Max Weber ist natürlich, dass man sagt, wenn es einen Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus gibt, was ist dann das auslösende Moment? War nicht der Protestantismus vielleicht einfach auch eine attraktive Religion für Leute, die ohnehin schon mit Gelderwerb beschäftigt waren und sich aus kirchlichen Zinsverboten, aus kirchlichen Wirtschaftsrestriktionen lösen wollten? Die Historiker neigen heute sehr häufig eigentlich eher zu dieser Interpretation. Und nicht zu der, dass die Protestanten durch irgendeinen merkwürdigen Mechanismus auf einmal Kaufleute wurden." Soll heißen: Die vielzitierte Weber-These gilt eigentlich als widerlegt.
Nachdenken, Reflektieren, Disputieren
Das arbeitet auch Dirk Kaesler in seinem 1000-Seiter eindrucksvoll heraus. "Jahrzehnte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser sogenannten Weber-These haben gezeigt, dass sie in ihren Details, in theologischer, historischer und ökonomischer Hinsicht so nicht haltbar ist", sagt Dirk Kaesler. "Das ist unstrittig, und nur völlig fanatische Weber-Gläubige können diese These als das letzte Wort der Wahrheit verteidigen." Dennoch: Die Weber-These vom innigen Zusammenhang zwischen Protestantismus und Kapitalismus gehört zu den "Großen Erzählungen" des 20. Jahrhunderts. Und als solche, konzediert Kaesler, stimmt sie dann doch auch wieder irgendwie.
Darüber könnte man lange diskutieren. Aber egal. Max Weber - diese eminente Anregungsmaschine - fordert eben zum Nachdenken, Reflektieren, Disputieren heraus. Die Biografien von Dirk Kaesler und Jürgen Kaube sind, jede der beiden auf ihre Art, exzellente Inspiratoren dazu. Kaube kommt schneller auf den Punkt, dafür ist Kaeslers 1000-Seiter epischer, erzählerischer angelegt. Welchem von beiden Zugängen man den Vorzug gibt, bleibt letztlich Geschmackssache.