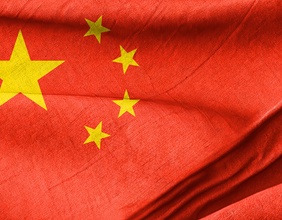USA: Behörden mit Zuwanderung überfordert
In den USA spitzt sich die Einwanderungskrise zu. Jedes Monat kommen tausende Frauen, Männer und Kinder aus Zentralamerika über die Grenze, sie fliehen vor Armut und eskalierender Gewalt in ihren Heimatländern Honduras, Guatemala und El Salvador. In den vergangenen Monaten haben amerikanische Grenzbeamte hunderttausende Menschen aufgegriffen, darunter mehr als 60.000 unbegleitete Kinder aufgegriffen.
8. April 2017, 21:58
Morgenjournal, 2.8.2014
"Zuhause ist es grauenvoll"
Erschöpft sitzt die 22jährige Beatriz an einem Klapptisch in der Sacred Heart Kirche und löffelt Hühnersuppe. Einen Monat lang war sie mit ihrer fünfjährigen Tochter unterwegs: Die Koyoten, wie die Schlepperbanden genannt werden, haben sie von ihrem Heimatland El Salvador bis zum amerikanischen Grenzfluss Rio Grande gebracht. "Wir haben am Ufer in einem Verschlag gewartet und dann haben uns die Koyoten zusammen mit 15 anderen in ein Plastikboot gesetzt. Das war um zirka 6 Uhr abends. Um 7 Uhr hatte uns schon die Grenzpolizei", sagt sie.
Beatriz ist eine von tausenden, die jedes Monat aus Zentralamerika in die USA fliehen. In ihrem Heimatland könne sie nicht mehr leben, erzählt die junge Mutter. "Zuhause ist es grauenvoll. An jeder Ecke herrscht Gewalt und Armut, täglich werden Leute getötet. Wir leben ständig in Angst und da versucht man eben, das Beste aus seinem Leben zu machen."
US-Behörden kommen nicht mit Ansturm zurecht
7.000 Dollar hat Beatriz den Koyoten bezahlt, Geld, das die gesamte Familie zusammengespart hat. Dass die Reise gefährlich sein würde, das wusste Beatriz. Das Risiko hat sie trotzdem auf sich genommen. "Ich hatte große Angst. Mich haben viele gewarnt, dass sie mir das Kind wegnehmen könnten, dass sie mich vergewaltigen oder töten könnten. Ich bin sehr erleichtert, dass ich es geschafft habe", erzählt sie.
Jeden Tag kommen hunderte Mütter, Väter und Kinder in die Sacred Heart Kirche in McAllen, im Süden von Texas. Viele laufen völlig orientierungslos in der Stadt herum, erzählt Schwester Norma Pimentel, denn die US-Behörden kommen schon lange nicht mehr mit dem Ansturm zurecht. "Wenn die Grenzpolizei die Einwanderer registriert hat, werden sie freigelassen. Sie bekommen Bustickets zu ihren Freunden und Verwandten und sollen dort auf ihren Asylgerichtstermin warten. Aber wenn sie zum Busbahnhof kommen, sind sie oft in schlimmem Zustand, sie waren oft wochenlang unterwegs, sind erschöpft, hungrig und brauchen Hilfe."
Hoffnung auf ein besseres Leben in den USA
Mit Geldspenden hat die Kirche eine Halle eingerichtet, die Stadt hat Schlafzelte zur Verfügung gestellt und die Heilsarmee kocht essen. Freiwillige Helfer erklären den jungen Müttern ihre Reiserouten, spielen mit den Kindern und hören zu. "Ich bin hier, weil mich diese Leute brauchen", sagt Mayra Garza, die jeden Tag in der Kirche mitarbeitet. "Niemand von denen kommt her, weil es ihm zuhause gutgeht. Viele flüchten vor den gefährlichen Gangs, die Frauen werden vergewaltigt. Ihre Männer werden ermordet."
Viele haben alles riskiert, um in die USA zu kommen. Die USA, das Land, von dem sie sich ein besseres Leben erhoffen. Aber noch ist ihre Reise nicht vorbei. Viele werden wieder zurückgeschickt, andere tauchen unter, leben als Illegale. Für Mayra ist das das schlimmste. "Es ist furchtbar traurig. Ich frage mich ständig, was wohl aus ihnen wird. Wissen Sie, die glauben, weil sie hier sind, ist endlich alles gut. Weil sie ihre Kinder in ein freies sicheres Land gebracht haben. Aber sie haben keine Ahnung, was sie hier erwartet", sagt Mayra.
Zumindest für kurze Zeit sollen sie es hier auch vergessen. Willkommen, rufen die Freiwilligen jedes Mal, wenn neue Familien zur Tür hereinkommen. "Wir wollen, dass die Leute wenigstens für einen kurzen Moment glücklich sind. Sie kommen rein, wir klatschen, die Kinder lachen. Einige weinen. Weil sie noch nie, an keinem Ort, freundlich in Empfang genommen worden sind."
Übersicht
- Migration