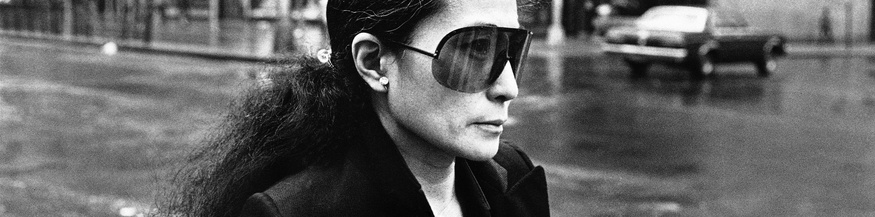Frieden schließen mit Demenz
Das Bild, das in der Öffentlichkeit von Demenz im Allgemeinen und Alzheimer im Speziellen geprägt wird, ist beunruhigend und angsteinflößend. Da ist von der unheimlichen Geißel des Alters die Rede und von der Vereinsamung durch Gedächtnisverlust, von der Hilflosigkeit wegen des Abhandenkommens kognitiver Fähigkeiten. Es ist hoffnungslos.
8. April 2017, 21:58
Welche Optionen bleiben bei Demenz oder Alzheimer? Weiter wegschauen? Oder darauf warten, dass das rettende Medikament gefunden wird? Für ihr Buch besuchte Sabine Bode Alten- und Pflegeheime, sprach mit Pflegepersonal und Wissenschaftlern. Und sie porträtiert Menschen, die unermüdlich versuchen, Demenzerkrankten dabei zu helfen, in Würde zu altern.
Reifeprüfung für die Gesellschaft
Für Sabine Bode ist Demenz ein großes Beziehungsthema, eine Reifprüfung für die Gesellschaft, denn es geht um ein zentrales Anliegen: die Pflege und Begleitung alter Menschen – sprich: die Zukunft jedes einzelnen von uns. Es geht dezidiert nicht um die Organisation und die Kosten der Pflege altersverwirrter Menschen. Es geht um die Vor- und Nachteile von Heimen, Wohngruppen oder Einrichtungen der Tagespflege. Die Wege, die dabei beschritten werden sind vielfältig und oft auch überraschend.
Zitat
Der Pfleger sitzt mit einer alten Heimbewohnerin, Frau Schmitz, am Esstisch und beobachtet, wie sie mit einer Wurstscheibe ihre Brille putzt. Die Dame ist sich ihrer Sache sehr sicher, will aber für das, was sie tut, auch anerkannt werden. Das verrät ihr kurzer Blick auf den Pfleger neben ihr - alles in Ordnung. Der schaut sie bewundernd an. Also putzt sie auch das zweite Glas. Dann setzt sie die verschmierte Brille wieder auf die Nase - und strahlt vor Freude. Was ihre Mimik deutlich macht: Sie verwendet die von ihr neu erfundene Brille als Kaleidoskop, in dem sich das Licht bricht.
Meist wäre die Reaktion wahrscheinlich: "Um Gottes Willen! Das ist würdelos, das darf man doch nicht zulassen, wenn das einer sieht!" Also wird die Scheibe Wurst sofort entsorgt, die Brille geputzt und sauber wieder auf die Nase gesetzt. So, Frau Schmitz, jetzt können Sie wieder sehen. Aber Frau Schmitz will gar nicht so sehen.
Demente Menschen kratzen an unserem modernen Bild von Persönlichkeit. Und viel Leid entsteht, wenn sie in ihrem Anderssein nicht verstanden werden. Oft blühen sie aber auf, wenn sie liebevoll begleitet werden.
Zertifizierte Demenz-Clowns
Es wäre so wichtig, schreibt Sabine Bode, die Schreckensszenarien in unseren Köpfen nach und nach durch Bilder und Informationen zu ersetzen, die die Angst vor Alzheimer nehmen. Einen Weg, einen guten Kontakt zu den Altersverwirrten herzustellen, sieht die Autorin in der Arbeit der Demenz-Clowns.
Demenz-Clowns werden etwa an einer Theaterakademie in Eindhoven in Holland ausgebildet. Der Beruf unterliegt strengen Kriterien. Nach einem Auswahlverfahren und 14-monatiger Ausbildung wird im Jahresabstand überprüft, ob die erlernten Standards beibehalten wurden. Wenn nicht, geht das Zertifikat verloren.
Das wichtigste Gebot eines Clown in der Demenzpflege lautet: auf keinen Fall einen Plan zu haben, nie dort fortzusetzen, wo man beim letzten Mal gute Erfolge hatte. Stattdessen darauf achten, wer - wie versteckt auch immer - den Auftritt überhaupt bemerkt. Aufgabe der Clowns ist schlicht: Die Heimbewohner zu verwöhnen, auf ruhige feinfühlige Art Kontakt zu den Menschen aufzunehmen und dabei auf kleinste Signale zu achten.
Der erste Mann, der sich einen Namen als Demenz-Clown machte, war der Schweizer Marcel Briand. Von ihm stammt der Satz: "Menschen mit Demenz und Clowns sind Seelenverwandte. Auch der Clown verhält sich auffällig und hat Probleme mit der Rationalität."
Erfolgreiche Validation
Was Menschen mit Demenz am wenigsten brauchen, ist Zeitdruck in der Umgebung. Zeitdruck setzt unter Spannung. Spannung erzeugt Widerstand bei den Betroffenen. Mit einem Blick auf die Zustände in den Psychiatrischen Anstalten macht Sabine Bode auch die Fortschritte in der Pflege und Betreuung altersverwirrter Menschen deutlich. Lange Zeit ging man davon aus, dass es nicht möglich ist, mit desorientierten Menschen überhaupt zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse zu verstehen und ihnen zu einem erträglichen Lebensabend zu verhelfen.
Einen völlig anderen Zugang entwickelte Naomi Feil. Sie begründete eine Kommunikationsmethode, die unter dem Namen Validation Eingang in die Pflege und Betreuung fand. Validation heißt, Menschen in ihrer Sicht auf die Welt und in ihren Gefühlen zu bestätigen. Man schaut nicht auf die Defizite, schon gar nicht hält man ihnen diese vor. Man akzeptiert die Menschen, wie sie sind, und erhält damit ihre Würde. Natürlich fällt dieses Bestätigen jenseits der eigenen Normalität anfangs schwer, es ist nicht leicht einzusehen, dass der eigene Vater, die eigene Mutter oder der Partner mit Rationalität nicht mehr zu erreichen ist.
Laut dem im Buch zitierten Psychiater und Neurologen Hans Förstl besteht der Wert der Validation vor allem darin, dass mit Hilfe dieser Kommunikationsmethode die Patienten wieder ruhiger und zufriedener werden. Ihr Selbstwert profitiert und der Streit um die "richtige" Wirklichkeit fällt endlich weg. Ein Konflikt, der das Verhältnis zwischen Angehörigen und Betroffenen sehr stark belasten kann.
Biomarker gesucht
Die Einzigartigkeit jedes Falls unterstreicht Sabine Bode mit einer Redensart, die unter Pflegern geläufig ist: "Sobald du einen Patienten mit Alzheimer gesehen hast, hast du einen Patienten mit Alzheimer gesehen."
Es gibt keinen einzigen biologischen Marker bei Alzheimerpatienten, der von Person zu Person konsistent ist. Der Wunschtraum der Alzheimerforscher wäre es, durch Reihenuntersuchungen die Erkrankung im noch symptomfreien Frühstadium erkennen zu können. Denn wenn es möglich wäre, schon für das präklinische Stadium Biomarker zu entwickeln, wäre auch eine Heilung möglich. Derzeit ist das aber noch nicht der Fall.
Mit der Frage, wer die aufwändige Pflege bezahlen soll, werde laut Sabine Bode nur die Wertediskussion vermieden. Die Menschenrechte, meint die Autorin, spielten bei der Pflege von Altersverwirrten keine Rolle. Sabine Bode blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft: "Wir kennen die Richtung und wir alle können dazu beitragen, damit eine Transformation gelingt."
Text: Bernhard Eppensteiner
Service
Sabine Bode, "Frieden schließen mit Demenz", Klett-Cotta