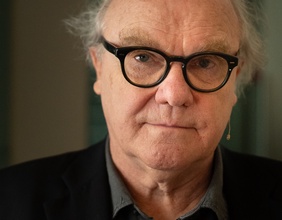"Wir können das Land nicht ändern, also ändern wir das Thema" (aus "Ulysses")
Leopold Bloom - ein echter Österreicher
Österreich gilt auch als Land der Literatur. Zu Recht. Wenngleich aus heutiger Sicht Elias Canetti gebürtiger Bulgare war, Joseph Roth Ukrainer, Franz Kafka Tscheche, ebenso wie Karl Kraus. Angesichts solcher europäischer Vielfalt ist es fast naheliegend, ja geradezu zwingend, James Joyce zum Österreicher zu erklären. Und mehr noch seinen Romanhelden Leopold Bloom, der bei naherem Hinsehen beinahe irrtümlich durch Dublin und nicht durch eine Stadt der k. u. k. Monarchie stolpert.
8. April 2017, 21:58
Doch beginnen wir mit dem Urheber und Autor: James Joyce kam um die Jahreswende 1904/05 erstmals nach Triest, frisch verheiratet und ohne große Berufsaussichten. Die Stadt selbst, bevölkert von Italienern, Slawen, Griechen, "Österreichern" und Ungarn, war ihm nicht sofort sympathisch – im Laufe der immerhin zehn Jahre, die er in Triest verbrachte, aber wurde sie ihm, wie er selbst meinte, zur einzigen Stadt, in der er schreiben könne. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als das Nationalitätenproblem Österreich-Ungarns, das Joyce in Triest näher kennenlernte, die Grundlage für seine Darstellung des von den Briten besetzten Irlands im "Ulysses" wurde. Speziell die Situation der italienischen Minderheit und der Ungarn sind beständiges Thema im "Ulysses".
Freiherr von Haynau
So etwa, wenn "Hauptmann Hainau, österreichisches Heer", im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung erwähnt wird. Tatsächlich war Julius Jakob, Freiherr von Haynau, bei der Niederschlagung der revolutionären Ausbruche 1848 und 49 durch seine besondere Brutalität in Italien wie auch in Ungarn berühmt geworden. Joyce schreibt den Namen des Freiherrn nicht, wie es richtig wäre, mit "Y", sondern mit einem "I", und nimmt so auch grafisch auf die Figur des Haines Bezug, der im ersten Kapitel den kolonialistischen Engländer bezeichnet und dessen Name nicht zufällig an das französische Wort "la haine", also den Hass gemahnt.
Freiherr Haynau war auch einer der großen politischen wie militärischen Widersacher Lajos Kossuths, des ungarischen Freiheitskämpfers, der nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution von 1849 durch seine Bekanntschaft mit Guiseppe Mazzini veranlasst wurde, eine ungarische Legion in der Armee Giuseppe Garibaldis aufzubauen. Garibaldi seinerseits wird unmittelbar im Zusammenhang mit Arthur Griffith, dem Gründer der Sinn Féin, im achten Kapitel des "Ulysses" erwähnt. In den Ungarn Lajos Kossuth wiederum verwandelt sich Leopold Bloom im zentralen, dem 15. Kapitel des Romans.
Freundschaft mit Italo Svevo
Die Minderheiten des Habsburgerreichs, vor allem Italiener und Ungarn, sind es schließlich auch, die maßgeblich zur Gestaltung jenes Leopold Bloom dienten, der an jenem 16. Juni 1904 so unbeholfen und doch weise durch Dublin stolpert: Vom Triestiner Autor Italo Svevo ist bekannt, dass er Bloom einige Charaktereigenschaften lieh, manche Wissenschafter gehen sogar so weit, das Freundespaar Svevo/Joyce im "Ulysses" als Bloom/Dedalus wiedererkennen zu wollen. Unbestritten ist, dass der Altersunterschied bei beiden Paaren circa ident ist und ihr Verhältnis problemlos in beiden Fällen als Vater-Sohn-Beziehung gelten kann.
Eine weitere Person, die wesentliche Eigenschaften an Leopold Bloom abgeben durfte, war Theodoro Mayer, ein Triestiner Zeitungsherausgeber, dessen Vater – wie jener Blooms – aus Ungarn stammte. Dass Bloom mitunter im "Ulysses" als "Leopoldo" angesprochen und bezeichnet wird, mag daher auch eine phonetische Anspielung auf Theodoro Mayer sein (neben jener auf Leopold Popper, den Vater einer Schülerin von Joyce). Und wie Svevo war auch Mayer Jude. Und er war italienischer Nationalist, Irredentist, der wie Joyces Bruder Stanislaus für eine nationale Einheit aller italienischsprachigen Gebiete eintrat.
Ungarn als Modell für Irland
Ungarn spielt aber nicht nur im Stammbaum Blooms eine bedeutende Rolle. In den ersten Monaten des Jahres 1904 verfasste Arthur Griffith eine Serie von Artikeln unter dem Titel "The Resurrection of Hungary", worin die Unabhängigkeit Ungarns von 1867 als Modell für jene Irlands diente. Im zwölften Kapitel des "Ulysses" wird Griffith mehrfach erwähnt, das Konzept einer "Resurrection", einer "Auferstehung" Irlands aus dem Geiste des ungarischen Nationalismus aber wird im "Ulysses" Bloom zugeschrieben: "Er ist es gewesen, der alle Pläne nach dem ungarischen Modell entworfen hat."
Die endgültige, definitive und vorbehaltlose Verösterreicherung Blooms findet sich freilich im berühmt-berüchtigten Circe-Kapitel des "Ulysses". Darin erhält Bloom die ungarische "eiserne St.-Stephans-Krone" und schlüpft wenige Zeilen später in die Rolle Kaiser Leopolds I.:
"Sehet, hier steht euer unzweifelhafter Kaiserpräsident und Königvorsitzender, der höchstdurchlauchtige, mächtige und gewaltige Lenker dieses Reiches. Gott schütze Leopold den Ersten!" Als solcher kämpft Bloom gegen die Sarazenen, ganz wie sein historisches Vorbild in den Jahren vor und vor allem nach 1683. Prompt scheitert der Kaiserpräsident Bloom im Circe-Kapitel mit seinem Reformprogramm und flieht. Nicht aus einem Staat, nicht aus einer Nation, nicht aus einem Land, nein, aus einem Bordell. Diese Episode lässt uns nun auch die drängende Frage beantworten, ob Leopold Bloom ein Österreicher war. Die Antwort lautet kaum verwunderlich: Ja. Wenngleich nur in seinen Albträumen.
Text: Meinhard Rauchensteiner, Autor und Berater des Bundespräsidenten für Wissenschaft, Kunst und Kultur