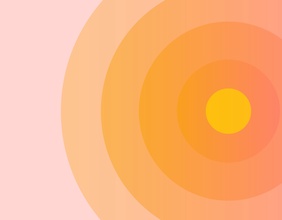Musikalisches Friedensgespräch in Berlin
"Zuhören" heißt ein Festival, das ab heute Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Konfliktgebieten der Welt im Berliner Radialsystem zusammenbringt. Die Choreografin Sasha Waltz hat zu musikalischen Friedensgesprächen eingeladen.
8. April 2017, 21:58
"Wir können den Wahnsinn von Gewalt und Terrors nur durch Kreativität überwinden", ist etwa Karim Wasfi, Dirigent und Cellist aus Bagdad, überzeugt.
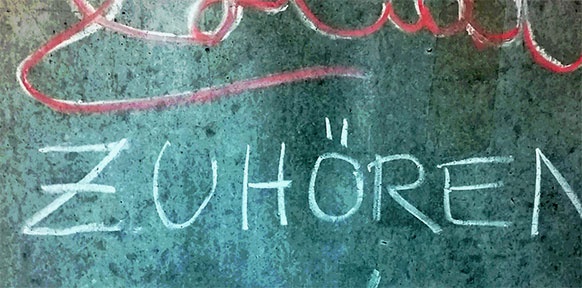
SASHA WALTZ
Kulturjournal, 3.2.2016
Service
Sasha Waltz - Zuhören: Gespräche
Radialsystem
CNN - Iraqi National Symphony conductor Karim Wasfi fights ISIS with music
Vimeo - "The Leader is Always Right", Film von Salome Jashi (Georgien 2010)
Musik schafft Toleranz - dieser Satz ist das Credo von Karim Wasfi, Dirigent des Irakischen Nationalen Symphonieorchesters in Bagdad. Im Smoking begann der Starmusiker während des alltäglichen Bombenterrors, inmitten der Trümmer von Bagdad, Cello zu spielen. Er will, sagt Wasfi, den Menschen mit seiner Musik die Würde zurückgeben: "Selbstwertgefühl, Zuversicht, Mitgefühl, globaler Frieden - all das entsteht aus Kultur."
Karim Wasfi ist einer von vielen Künstlern, die beim Festival Zuhören in Berlin aufzeigen, wie die Konflikte dieser Welt nicht durch noch mehr Gewalt, sondern durch positive Werte, durch Kultur zu überwinden sind. Für die Organisatorin Sascha Waltz zeige vor allem die Kunst den Weg aus der Krise auf. "Dieses Festival ist für mich die Antwort auf die Angst. Es ist für mich der positive Ausdruck, wie wir mit Krise umgehen. Krise bedeutet Veränderung. Transformation. Das kann sich eben auch positiv auswirken. - Was jetzt für ein Reichtum an Künstlern in dieser Stadt lebt, das ist wirklich begeisternd. (...) Das ist ein Schatz, den es zu heben gilt", so Waltz.
Orthodoxe Kirche in Georgien
Zu diesem Schatz gehören inzwischen auch Salome Jashi und ihr Mann, der bekannte Schriftsteller Zaza Burchuladze. Nachdem sich beide kritisch über die orthodoxe Kirche in Georgien geäußert hatten, sei ihr Mann verprügelt und bedroht worden. Das Künstlerehepaar musste Georgien verlassen und floh nach Berlin. Die orthodoxe Kirche in ihrer Heimat sei nicht nur islamfeindlich, sondern lehne alle Veränderungen der Neuzeit ab: Rechte für Homosexuelle oder Gleichberechtigung von Frauen.
In einem Dokumentarfilm hielt Salome Jashi fest, wie sich Regierung und orthodoxe Kirche in Georgien dem gesellschaftlichen Wandel noch immer mit den Methoden des vergangenen Jahrhunderts entgegenstellen: "‘Der Führer hat immer Recht‘ war der Titel meines 2010 gedrehten Films. Es geht dabei um patriotische Kamps in Georgien, die sehr populär waren." Teenager, die 15 bis 20 Jahre alt waren, wurden von der Regierung eingeladen, an einem Sommerferienlager teilzunehmen, erzählt Jashi: "Jeder Tag begann mit dem singen patriotischer Lieder. Außerdem hatte jedes Lager eine Gebetsecke. Alle Kinder, ob orthodox oder nicht, mussten in einer Reihe stehen und zusammen beten."
Die Kirche in Georgien propagiere mit ihren nationalistischen Parolen nicht nur die Werte der Vergangenheit. Priester greifen ganz offen jeden an, der ihren Moralvorstellungen widerspricht. "Als in Tiflis eine kleine Gruppe Homosexueller einmal wagte, für gleiche Rechte auf die Straße zu gehen, wurden sie von 5.000 Menschen durch die Stadt gejagt; ganz vorne bei dem Mob liefen Priester mit. Mit Stuhlbeinen schlugen sie auf einen Minibus ein, mit dem Polizisten die Homosexuellen in Sicherheut bringen wollten. Für den Gewaltakt verurteilt - oder auch nur angeklagt - wurde niemand", erzählt Jashi.
"Wo Staaten versagen, bleibt nur die Kunst"
Wo Staaten und Rechtsysteme komplett versagen, schaffe es nur die Kunst, eine angemessene Antwort zu geben, ist auch Karim Wasfi überzeugt. Islamische Extremisten im Irak versuchten, den Koran Wort für Wort zu interpretieren; doch Selbstmordattentate oder Steinigungen seien keine islamischen Werte, die den Menschen ihre verlorene Würde wiedergeben. Für Wasfi ist der Koran nur als Poesie zu verstehen; die Verse zu rezitieren klinge wie Musik, darin sieht er die eigentliche Botschaft des heiligen Buches. Wie die Musik ist es ein Teil des kulturellen Erbes, das unser Zusammenleben in einer großen Weltgemeinschaft erst möglich macht.