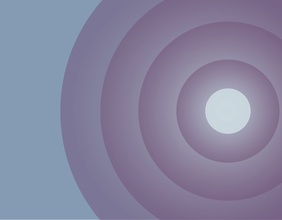Roman von Henri-Pierre Roché
Jules und Jim
Der Erfolg von Francois Truffauts Film "Jules und Jim" aus dem Jahr 1962 rückte auch den bis dahin erfolglosen Autor Henri-Pierre Roché ins Rampenlicht, der 1953 den gleichnamigen Roman verfasst hatte. Das Werk über zwischenmenschliche Beziehungen unter Ausschaltung der Moral war sein literarisches Debüt - mit 74 Jahren. Patricia Klobusiczky hat es neu ins Deutsche übertragen.
8. April 2017, 21:58

Schöffling Verlag
Service
Henri-Pierre Roché, "Jules und Jim", Roman, aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky, Schöffling Verlag
Erste freundschaftliche Gefühle
"Jules und Jim" ist eine auf den ersten Blick denkbar einfache Geschichte. Diese Einfachheit ist beabsichtigt: Roché hat seinen Text in mehrfachen Durchgängen sprachlich so reduziert, dass die Sätze nichts anderes abbilden, als den Sachverhalt, den sie beschreiben. Keine Wertung, keine Erklärung, keine Beschreibung. Das Ganze klingt eher wie ein Protokoll.
Beziehungen unter Ausschaltung der Moral
Zwei junge Männer begegnen einander in Paris. Wir wissen fast nichts von ihnen, außer dass Jules Deutscher ist und Jim Franzose. Und dass sie irgendetwas mit Kunst zu tun haben. Jules jedenfalls schreibt, was genau, erfahren wir nicht. Bei Jim ist die Sache noch unentschiedener. Vermutlich wissen beide nicht, was aus ihnen werden soll. Sie wissen allerdings, was sie haben wollen: Spaß nämlich, und das bedeutet vor allem amouröse Abenteuer. Wobei die Quantität wichtiger ist als die Qualität.
Roché hat die Liebe aus seinem Roman ebenso gestrichen wie überflüssige Vokabeln und Erklärungen. Es gibt Verliebtheit, Begehren, mitunter auch einen gewissen Grad der Zugeneigtheit, aber all das hat keinen Bestand. Man könnte auch sagen: "Jules und Jim" ist ein Roman über zwischenmenschliche Beziehungen unter Ausschaltung der Moral. Es ist keine Liebesgeschichte, es ist vielmehr eine Geschichte über Willkür und Zufall, weil Gefühle immer nur den Moment beherrschen und keine Dauer haben.
Das Leben - endlose Ferien
Eines Tages lernen Jules und Jim die Deutsche Kathe kennen. Sie umschwärmen sie nach allen Regeln der Kunst, weil sie schwierig ist - aus der Sicht der jungen Männer jedenfalls. Kathe ist selbstbewusst und hat die Lage gern im Griff. Sie möchte führen und sich nicht führen lassen. Sie heiratet Jules, geht mit ihm zurück nach Deutschland, bringt zwei Töchter zur Welt. Doch das bürgerliche Experiment der Ehe geht schief, weil die Eheleute nichts aneinander finden, was über das momentane Begehren hinausgeht. Und neben einigen Zufallsbeziehungen ist da immer noch Jim, der dritte im Bunde, der weder seine Freundschaft mit Jules noch sein Interesse für Kathe aufgeben möchte.
Die Geschichte von Jules und Jim, die im Jahr 1907 beginnt, reicht bis weit in die Zwischenkriegszeit, als in Jules‘ Heimat nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs die Weimarer Republik mehr schlecht als recht versucht, sich gegen linke und rechte Umstürze zu behaupten. Nichts davon bildet der Roman ab, auch nicht den Ersten Weltkrieg, der die Freunde für Jahre trennt. Es ist schon erstaunlich, wie Henri-Pierre Roché seine Figuren scheinbar unbeeindruckt von äußeren Verhältnissen agieren lässt. So wie er keine Moral zulässt, verweigert er ihnen jegliches politische Bewusstsein, jegliche Fähigkeit, analytisch zu denken. Jules, Jim und Kathe funktionieren immer nach demselben Muster, sie altern nicht und statt Erfahrung gibt es Wiederholung. Die Wiederholung allerdings stumpft ab.
Autobiografisch gefärbt
Als der Roman "Jules und Jim" 1953 erschien, wusste so gut wie niemand, dass es sich um einen autobiografisch gefärbten Text handelte. Henri-Pierre Roché war so wenig bekannt wie das aus Berlin stammende Ehepaar Franz und Helen Hessel. Neben der Ehe hatte Helen Hessel über dreizehn Jahre hinweg eine Beziehung mit Henri-Pierre Roché. Der war fest in der Pariser Boheme integriert, malte und schrieb, nichts davon allerdings konsequent. Er war mit Pablo Picasso und Gertrude Stein befreundet und ließ seinen deutschen Freund teilhaben am lockeren Leben in und abseits der Salons. 1921 ließen sich Helen und Franz Hessel scheiden, damit Hessel und Roché zusammenleben konnten. Im Sommer 1922 heirateten Helen und Franz Hessel erneut, obwohl ihre Affäre mit Roché weiterhin bestand. Das ist der Stoff, aus dem Jules und Jim gemacht ist, der Stoff, den Roché durch sein Leben getragen hat, als die Beziehung längst vorbei war. Im Roman sind es eben nicht die schwierigen Bedingungen des Lebens und Überlebens in unsicherer Zeit, die für eine Entfremdung zwischen Jules, Jim und Kathe sorgen, sondern schlichtweg Übermüdung.
Das Finale des Romans ist dann eine verdichtete Anleitung zum Unglücklichsein. Jules ist mit Kathe verheiratet, hat sie aber längst an Jim verloren. Jim ist traurig über den Umstand, dass er nicht Lucie geheiratet und mit ihr Kinder in die Welt gesetzt hat. Kathe möchte Jules nicht verlieren und sehnt sich danach, von Jim nicht nur begehrt, sondern auch geliebt zu werden. Jim weiß nicht, was Liebe ist. Jules weiß nicht, was Liebe ist. Kathe könnte nicht sagen, was sie von den beiden überhaupt will. Und es kommt, wie es kommen muss, wenn das Wollen nicht zielgerichtet ist, wenn keine Seelenspeise der Welt den Seelenhunger zu stillen vermag. Nur Jules wird überleben, um sich zu erinnern. Ob er aus der Erfahrung klüger wird, erfahren wir nicht.
Truffaults Romanverfilmung
Henri-Pierre Roché schrieb dann noch einen Roman mit dem Titel "Die beiden Engländerinnen und der Kontinent"; 1959 starb der Autor. Kurz vor seinem Tod stand er mit Francois Truffaut noch in Kontakt, der ihm von seinem Plan erzählte, "Jules und Jim" zu einem Drehbuch umarbeiten zu wollen. Dass daraus dann tatsächlich etwas wurde, erlebte er nicht mehr. Die flotte Dreiecksgeschichte mit Jeanne Moreau, Oskar Werner und Henri Serre in den Hauptrollen gilt als zentrales Werk der Nouvelle Vague, des französischen Autorenfilms.