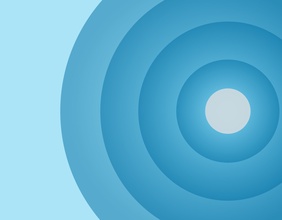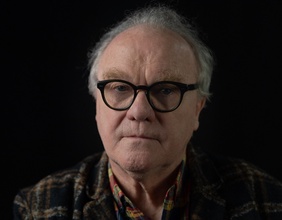Bibelessay zu Lukas 23, 35b – 43
„Ein starker Führer, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern muss“: 20% der Österreicherinnen und Österreicher bejahten 2008 laut Europäischer Wertestudie ein solches politisches System.
8. April 2017, 21:58
Seit 1990 findet sich diese autoritäre und antidemokratische Einstellung konsequent bei bis zu einem Fünftel der Bevölkerung. Übrigens nicht nur in Österreich: Die autoritär-faschistische Vergangenheit des 20. Jahrhunderts wirkt sich bis heute auf die politischen Einstellungsmuster in West- und noch stärker in Osteuropa aus. 55 Millionen Kriegsopfer im Zweiten Weltkrieg, 6 Millionen ermordete Juden, 10 Millionen Opfer des Kommunismus konnten den Autoritarismus nicht beseitigen. In Europa gibt es derzeit mehr als 20 Parteien, die als neofaschistisch, rechtsautoritär oder rechtspopulistisch eingestuft werden. Der Autoritarismus feiert fröhliche Urständ‘ – auch weltweit.
Ist sie unausrottbar, diese Sehnsucht der Menschen nach starker Herrschaft, nach politischen Führern, nach Unterwerfung und Aufgabe der eigenen Identität? In der Psychoanalyse begründet man dieses Phänomen mit dem kindlichen Wunsch nach Sicherheit und Schutz, die Menschen ihre Freiheit und Verantwortung abgeben lässt. Vor allem in sozioökonomischen Krisenzeiten werden diese Sehnsüchte aktiviert.
Auch die biblische Tradition weiß um dieses Problem und reflektiert in ihren Texten kritisch die Frage nach der politischen Macht und die Sehnsucht der Menschen nach einem mächtigen „König“, der über sie herrscht. Gelernt wird dabei, dass die Konzentration von politischer und ökonomischer Macht in der Hand Einzelner regelmäßig in die politische Katastrophe führt: zu Unrecht und Ungerechtigkeit, zu Unterdrückung und Ausbeutung, zum Ausschluss von Sündenböcken aus der Gemeinschaft. Gelernt wird, dass Gott politische Herrschaft nicht legitimiert, sondern langfristig immer auf Seiten der Ohnmächtigen steht.
Man kann die Heilige Schrift auch lesen als Lerngeschichte im Umgang mit politischer Macht. So entwerfen die Verfasser der biblischen Texte alternative Herrschaftsmodelle, die auf der Teilhabe aller an der politischen Macht und einem Rechtssystem basieren, das soziale Gerechtigkeit sichern soll. Macht wird umgedeutet: Sie soll im Dienst der Menschen stehen und dem guten Leben jedes einzelnen und der ganzen Gemeinschaft dienen. Macht ist Dienst. Macht verzichtet um des guten Lebens und des Friedens willen auf Gewalt. Gott selbst teilt von der Genesis an seine Macht mit den Menschen und beteiligt sie an der Verantwortung für die Welt. Der Verzicht auf Durchsetzung von Macht mittels Gewalt kann bis zur Ohnmacht führen.
Jesus von Nazareth steht in dieser Lern-Tradition. Er setzt seine Macht niemals mit Gewalt durch. Und so stirbt er ohnmächtig am Kreuz. Diese Ohnmacht aber wird von jenen, die in ihm den Messias erkennen, als Ausdruck göttlicher Macht erkannt: Gottes Allmacht zeigt sich in der Ohnmacht des Gekreuzigten.
Der Kreuzestod Jesu enttäuscht die Hoffnungen all jener, die auf einen mächtigen König gehofft haben, der mit Gottes Segen sein Reich durchsetzen wird. Dieser König ist ein König anderer Art. Seine Macht zeigt sich in der Anerkennung menschlicher Ohnmacht. Das ist die Voraussetzung der Auferweckung durch Gott, der als einziger Macht über Leben und Tod hat, so der Glaube der biblischen Verfasser.
Das heutige Evangelium erzählt davon, dass diese göttliche Logik von jenen nicht verstanden wird, die damals auf Macht und Gewalt setzen: die religiösen und politischen Führer, die Soldaten, ein Verbrecher verhöhnen und verspotten Jesus am Kreuz. Wäre er wirklich ein König, müsste er sich ja selbst helfen können. „Was für ein lächerlicher König!“ Das haben sich die Feinde Jesus damals gedacht, das würden sich vielleicht auch nicht wenige jener Menschen denken, die sich heute einen Führer wünschen oder selbst Führerambitionen haben.
Das Evangelium von heute desillusioniert alle Vorstellungen, dass die Erlösung der Menschen mit politischer Gewalt durchgesetzt werden kann. Es verlangt, sich von politischer Macht nicht blenden und verführen zu lassen, auf den Wunsch nach Führern zu verzichten und selbst Verantwortung für das Leben zu übernehmen. Es setzt auf die Hoffnung, dass auch und gerade aus der Ohnmacht neues Leben entstehen kann.