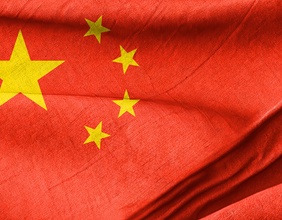ORF/URSULA HUMMEL-BERGER
Ö1 Schwerpunkt
Hertha Kräftner zum 90. Geburtstag
Zu Lebzeiten Kräftners waren von ihr lediglich einige Gedichte in Zeitungen und Zeitschriften erschienen. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der österreichischen Nachkriegszeit.
20. April 2018, 17:51
Ich werde mich auflösen in einen Gedanken an Weiden und eine Fähre über den Fluss.
Im Allgemeinen kommt man dem Tod auch ohne suizidale Gedanken immer näher, rückt im Leben langsam Reihe für Reihe nach vorn, bis man sich plötzlich in der ersten wiederfindet und wider Willen beste Aussicht auf ihn hat. Hertha Kräftner setzt sich gleich zuvorderst hin und beobachtet genau. Da muss sie sein, ein Leben lang, die Todesnähe ist ihr Zuhause, ihre Seelenlandschaft, an der sie leidenschaftlich malt. "Ihre rastlose Treue gehörte dem Tod. In manchen Stunden gestand sie sich diese Liebe so sehr ein, dass es ein Rausch wurde, wie ihn einer empfindet, der töten will. Aber sie war ihr eigenes Opfer."
Geboren am 26. April 1928 in Wien, zieht sie als Kind mit ihrer Familie nach Mattersburg. Sie ist ein ruhiges, klares Mädchen, besucht das Realgymnasium und schließt mit Auszeichnung ab, erlebt den Krieg und die folgende "Russenzeit" und wird als junge Frau Augenzeugin einer absurden Rauferei in ihrem Elternhaus, bei der ihr Vater von einem Besatzungssoldaten so schwer verwundet wird, dass er später seinen Verletzungen erliegt.
Sie übersiedelt 1947 nach Wien zu Tante und Großmutter und beginnt mit dem Lehramtsstudium der Germanistik und Anglistik, besucht Vorlesungen über Psychologie, später beschäftigt sie sich mit Philosophie und Ästhetik. Und beginnt zu schreiben. Wissensdurstig ist sie und literarisch begabt, ihre frühen Texte sind düster, spiegeln Freude an Widersprüchlichkeit und Unklarheit.
Es gefällt mir, meine Gefühle zu sezieren. Ich habe etwas erkannt: dass ich zwei Leben lebe. Die Wirklichkeit besitzt mich nie ganz. Die Träume sind von einer gefährlichen Süße. Aber ich fühle nichts vom Rausch und meine Lippen schmecken jetzt schon bitter. Ich werde zu Ende trinken.
Ihr erster Mentor ist der Lyriker Hermann Hakel, Vorstandsmitglied des österreichischen P.E.N.-Clubs und Herausgeber der Zeitschrift Lynkeus. Er druckt im Oktober 1948 ihr erstes Gedicht: Einem Straßengeiger. In Wien schlagen ihr die Nachkriegssplitter ins Gesicht, das allgemeine Reinwaschen hat begonnen, die Propaganda für das politische Überleben durch eine Gesellschaft, die ihre moralischen Leichen unter dem Teppich des Gemeinwohls entsorgt.
Aber sie beschließt, "ohne Gedanken an die Situation in Europa" zu schreiben, sie orientiert sich an Trakl, Rilke, Kafka, Sartre, Camus. Sie formt ihre Sprache mit den dunklen Seiten ihrer Seele. "Ist denn niemand da, der mir die Einsamkeit von der Stirne nimmt?" Und landet als eine der Jüngsten mitten auf dem neuen, kargen Boden der Nachkriegsliteratur.
An der Universität freundet sie sich mit dem Psychotherapeuten Viktor E. Frankl an, dem Begründer der Existenzanalyse, der sie anfangs 1950 mit Hans Weigel und seinem literarischen Zirkel im Café Raimund zusammenbringt. Korrespondenzen u. a. mit Friederike Mayröcker, Jeannie Ebner, H. C. Artmann, Andreas Okopenko zeugen vom angeregten Umgang mit der künstlerisch bestimmenden Szene. Trotzdem bleibt der Gedanke an den Freitod ihr alltäglicher Begleiter, ihre Depressionen verstärken sich.
Ich bin krank, die Beschäftigung mit der Psychologie erzeugt die meisten Psychopathen. Ich bin melancholisch. Dazu kommt noch eine Neurose. Wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. Die Anfälle kommen immer häufiger.
Sie sucht seelische Hilfe bei Viktor Frankl, hofft nichts weniger, als den Sinn ihrer Existenz zu verstehen. Die Sitzungen zeigen Wirkung. Ihre Sprache verdichtet sich, die Textsammlung Beschwörung eines Engels und ihre Litaneien entstehen. Hans Weigel rät ihr, einen Roman zu schreiben, die progressive Kulturzeitschrift Neue Wege druckt und Radio Wien sendet ihre Gedichte.
Ihre Texte der letzten zwei Jahre sind Anleitungen, über den Tellerrand hinaus ins Jenseits zu blicken, Essays über Sehnsucht und Angst vor deren Erfüllung. Ihr Leiden wird Ekstase, ihre Liebe zu wem auch immer ist Schwester der Einsamkeit. Befindlichkeiten wechseln jetzt schlagartig, lodernde Traurigkeit erschlägt manische Lebensfreude und umgekehrt.
Ich möchte Hymnen singen, die klar und schön sind vor Wohllaut, / oder Worte sprechen, die wie ein Dickicht sind, / in dem du dich verirrst und dich verletzt an brennenden Disteln. / Gibt es nichts anderes als Eis in der Ferne / und Brand im eigenen Haus?
Sie schreibt, liebt und lebt im existenzialistischen Augenblick, ihre Beziehungen haben keinen Bestand, ihre endlosen Briefe an Harry, Otto und Wolfgang offenbaren schamloses Entblößen bis unter die Haut, ins Fleisch, ins Herz und tiefer, und so voll von verzweifelnder Hoffnung, dass Zweifel aufkommen, ob man überhaupt das Recht hat, all das zu erfahren.
"Ein Mann, den ich nicht genug liebte, dass es mich am Leben gehalten hätte, sagte einmal: Sich töten? Wozu? Das führt doch zu nichts. Das ist es: Es führt zum Nichts. Dort will ich hin."
Und dann, mit 23 Jahren vereint sie alle ihre Kräfte und fordert vom Tod, ihrem Tod, die Erlösung.
Der Tod ist etwas Sauberes. Er wäscht alle Lügen auf.
Hertha Kräftner stirbt am 13. November 1951 an einer Überdosis Veronal.
Die Texte, die zu ihren Lebzeiten in Zeitschriften veröffentlicht worden sind, würden lediglich ein elend schmales Bändchen füllen. Und trotz aller Düsternis: Es ist befreiend, sich den verletzenden Kaskaden ihrer Texte hinzugeben, mit Demut, Respekt und Neugier. Eine Welt öffnet sich, liest man Hertha Kräftner, ein schmaler, schnurgerader und klarer Weg, der zum Spiegel hinführt, den sie als Bild der Ewigkeit auf Erden niedergeschrieben hat.
Text: Stefan Weber
Hinweis
Die Zitate stammen aus Hertha Kräftners Buch "Kühle Sterne" (Wieser Verlag)