
ORF/JOSEPH SCHIMMER
Ex libris
Schattenfroh - Ein Requiem
Der neue Roman von Michael Lentz umfasst tausend Seiten, die es in sich haben.
18. November 2018, 16:00
Ex libris | 21 10 2018
"Lesen und Schreiben sind eine Tateinheit", sagt der deutsche Schriftsteller, Musiker und Literaturwissenschaftler Michael Lentz. In letzter Zeit hat er sich mit Veröffentlichungen etwas zurückgehalten. Mit dem Erscheinen seines neuen Romans "Schattenfroh - Ein Requiem" weiß man nun eines: Michael Lentz hat sich Zeit, sehr viel Zeit gelassen, um vielleicht sein Opus Magnum zu schreiben. 1.008 Seiten umfasst das Werk, in dem er vom Entstehen und Verstehen von Literatur, vom Grundsätzlichsten also, worüber man sich als Autor äußern kann, erzählt. Als Katalysator dient ihm dabei der eigene Vater, auch das etwas sehr Grundsätzliches, der Ursprung als Thema.
Gehirnwasser
Die Anfangssituation des Romans ist düster: Der Ich-Erzähler sitzt in einer Art Zelle, völlig abgeschottet von der Außenwelt. Er trägt eine "Gesichtsmaske", seine Zunge scheint gelähmt zu sein, er kann nicht sprechen. Aber er kann denken und schreiben. Und alles, was er denkt und schreibt wird wiederum in einem - vielleicht digitalen - Buch aufgezeichnet. Das erzählende Ich nennt diesen Vorgang "Gehirnwasser".
Mein Schreiben muss eine Projektion der Gehirnwasserschrift sein. Denn ist das Gehirnwasser nicht die Seele? Ich habe im Kopf nachgeblättert: Liquor cerobrospinalis. Das immerhin kann ich, im Kopf nach Wörtern suchen. Die Sache selbst ist die Schrift, und alles spricht nur sich selbst aus. Und es gibt so viele Sachen, aber kein Jenseits der Sprache.
"Liquor cerobrospinalis" ist der Fachausdruck für "Gehirnwasser" - eine helle, farblose Flüssigkeit, die sich in den Hohlräumen des Gehirns befindet. Man könnte sagen: Das "Gehirnwasser" sei die "Nahrung" des Gehirns.
Ein philosophischer Schachzug
Die Figur namens "Schattenfroh" ist im Roman ein allmächtiger böser Geist. Er steht der "Furchtbringenden Gesellschaft" vor. Hier nimmt Michael Lentz eine sarkastisch-literarische Anleihe bei der "Fruchtbringenden Gesellschaft" - der ersten deutschen Sprachakademie zur Zeit des Barock, die mit Machtanspruch den Sprachgebrauch ihrer Zeit regulierte. Die Anfangs- und Grundsituation im Roman „Schattenfroh“ hat eine bestimmte philosophische Denkfigur aus der Barockzeit zur Basis: René Descartes‘ "Ich denke, also bin ich". Dieses Postulat - so wie es Descartes in seinen "Mediationen" darstellt - ist in seiner Unerschütterlichkeit nur mittels eines Gedankenexperiments feststellbar: Alles, was das "Ich denke" wahrnimmt, sei Illusion, Gaukelei, eine rein virtuelle Welt.
Im Roman "Schattenfroh" erfolgt das Schreiben als "Gehirnwasserschrift" via "Gesichtsmaske". Doch selbst wenn alles, was das schreibende " Ich" sieht und denkt, bloß vor-gespielt sei, so ist es doch das "Ich denke", welches das Vor-Gespielte wahrnimmt. Dieser philosophische Schachzug einer allumfassenden Täuschung gelingt nach Descartes allein durch einen "genium aliquem malignum", durch einen allpotenten "bösen Geist" - bei Lentz heißt er "Schattenfroh". Wer ist aber dieser "böse Geist" - eine literarische Fiktion getarnt als philosophisch-existentielle Denk- und Spielfigur?
Auf Wiedersehen, lieber Vater, du warst und wirst immer sein mein Deus absconditus, der sein Angesicht verbirgt, mein Schattenfroh, der abwesend immer anwesend ist.
Die Vater-Figur spielt im Roman eine übergroße Rolle. Sie ergibt aber als Denk- und Spielfigur nicht bloß Erinnerungen des Autors an seinen toten Vater, sondern sie besetzt das gesamte Bedeutungsfeld: Vater als persönlicher Vater, Vater als patriarchisches Ordnungsprinzip, Vater als "pater noster" als das Priesterliche, Fürstliche, als Gott - eben als "Deus absconditus", als sich verbergender, vielleicht "böser" Gott.
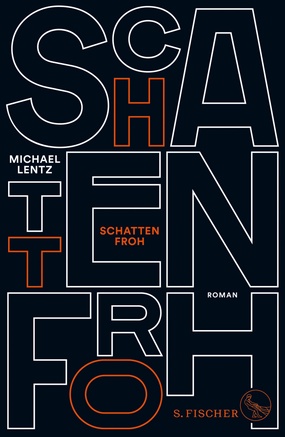
S. FISCHER
Ein vielschichtiges Gewebe
Die Grundsituation des Romans beschreibt die denkende und schreibende Ich-Instanz als Gefangener innerhalb seiner "Gesichtsmaske". Der böse Geist "Schattenfroh" zwingt ihn ein Buch, das Buch seines Lebens zu schreiben - also das personal besetzte Buch der Bücher. Auf der zweiten Ebene geht es um die Geschichte der Ich-Instanz, vor allem um seine Beziehung zum Vater. Das lässt aufhorchen. Denn 2001 gewann Michael Lentz den Ingeborg-Bachmann-Preis für seine Prosaarbeit "Muttersterben", in der er das Abschiednehmen von der totkranken Mutter schildert. Im Roman "Schattenfroh" nennt denn auch Lentz mehrfach dieses Prosastück und die "Mutter"-Figur ist präsent. Die dritte Ebene von "Schattenfroh" beschreibt Macht- und Kriegsverhältnisse von der Barock-Zeit über den Nationalsozialismus bis in unsere Tage. Die vierte, und wenn man so will existentiell höchste Ebene umfasst Reflexionen über den Tod, über Religion und Gott.
Die fürchten sich so vor dem Tod, vor dem Tod des anderen als Stellvertretertod des eigenen Todes, dass sie ihn mit keiner Silbe würdigen, den Tod, dass sie das Sterben nicht aussprechen, täglich geht es besser, auch dem Todkranken geht es täglich besser, er hat sich nur kurz hingelegt.
Dazu kommen im Roman noch einige Schriftexperimente, also handschriftliche Aufzeichnungen, Bildtafeln, Symbole, schwarze und weiße Seiten, Montage von Fremdtexten. Nicht selten finden sich zudem Lyrikeinschübe.
Literarische Reflexion
Der Roman "Schattenfroh" ist ohne Zweifel eines der interessantesten Experimente der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahre. Michal Lentz geht hier aufs Ganze: Er schreibt eine Prosa, die auf weiten Strecken enormes erzählerisches Können zeigt. Er schreibt eine Prosa der inneren Reflexion, die sich literarisch schwer zu fassenden Themen stellt - wie dem "Ich denke und ich schreibe", wie Gott, Teufel und Glaube. Und der Tod, der allgegenwärtige Tod, wird dennoch das Geschriebene nicht völlig auslöschen können. Zugegeben, "Schattenfroh" ist keine einfache Lektüre, aber eine, die den Leser mit den existentiellen Fragen des Lebens konfrontiert - und dies auf literarisch durchdachte und vielschichtige Weise.
Service
Michael Lentz, "Schattenfroh - Ein Requiem", S. Fischer Verlag







