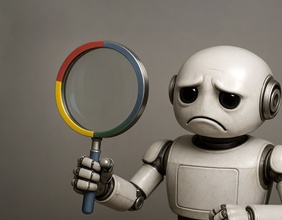KHM-MUSEUMSVERBAND
Ö1 Kunstgeschichten
"Drei Pferde, von meiner Schwester gesungen" von Herbert Maurer
Wolfgang Heimbach (1615-1678) war ein norddeutscher Porträt- und Genremaler der Barockzeit. Das Kunsthistorische Museum in Wien besitzt von Heimbach ein "Nächtliches Bankett". Der Wiener Autor Herbert Maurer lässt in seinem Text den gehörlosen Maler den Lärm des nächtlichen Banketts malen. Aus diesem Bild reitet Wolfgang Heimbach schließlich mit seiner geliebten Schwester in die Landschaft hinaus. Die Ö1 Erstveröffentlichungsreihe "Kunstgeschichten" widmet sich dem Kunstblick von Autorinnen und Autoren. Redaktion: Edith-Ulla Gasser.
17. Juli 2019, 12:22
Neue Texte | 21 07 2019
Ö1 Kunstgeschichten - "Drei Pferde, von meiner Schwester gesungen" von Herbert Maurer. Es liest der Autor.
Wörter brauchen keinen Laut, sie brauchen Atem, sie bewegen sich wie Menschen, wie Du, ob sie nun singen oder nicht, selbst im Schlaf können sie flüstern und machen Bilder im Kopf, schrieb Heimbach an seine Schwester, die ihm, dem Taubstummen, mit geübten Händen die Sprache der Menschen übersetzte. Sie malte ihm die Wörter in die Luft:
Ein Pferd war mit einer zarten Geste ihrer Hand in einem Augenblick gezeichnet und so wirklich, dass der Bruder dessen Atem roch. Schlaf war das Ruhen ihrer Hand zwischen Mittag und Abend, ein Sperling wie das Flattern der Hand im Wind, Nacht war der Schatten zwischen beiden Händen oder das Dunkel in ihrem halbgeöffneten Mund, Fische waren so nass wie ihre Haare, wenn sie sich den Mittagswein lachend über ihren Kopf zu gießen pflegte. Freude war so schlank und schön wie ihre Finger, Trauer tat weh wie ein gebrochener Daumen. War die Schwester müde, dann schliefen zuerst ihre Hände, während sie noch singen mochte, doch Heimbach legte seine Stirn in ihre linke Hand und schlief schnell ein.
Ich male im Schlaf, dort sind die Farben leicht wie der Wind, denn ich schlafe offenen Auges und rieche die Farben darin, das schrieb der Maler gerne seiner Schwester in die Hand, oder auf die Rückseite des Gemäldes "Drei Pferde, von meiner Schwester gesungen".
Sei unbesorgt, antwortete die Schwester mit der anderen Hand, was ich singe ist das, was Du siehst; was Du malst ist das, was ich höre. Nicht dunkel genug konnten der Schwester die Bilder ihres Bruders sein. Als stünde ich mit geschlossenen Augen in der Landschaft, so will ich Deine Landschaft sehen, wünschte sie sich immer wieder, und ihr Bruder malte gern danach. Für ihn schien der Klang ihrer Stimme im Finstern am schönsten.

Herbert Maurer, geboren 1965 in Wien, studierte Sprachenwissenschaften in Venedig, Jerusalem, Köln, Bilbao und Jerewan. Während seines dreijährigen Aufenthalts in Armenien arbeitete er für die österreichische Erdbebenhilfe und als Journalist für internationale Medien. Herbert Maurer schreibt Essaybände, Erzählungen und Theaterstücke, außerdem übersetzt er armenische Gegenwartsliteratur. In seinem aktuellen Buch "Was von uns bleibt - Lebensweisheiten vom Grabesrand" erzählt er von seinen Erfahrungen als Trauerredner. Herbert Maurer wurde unter anderem mit der Franz-Werfel-Medaille und dem Rheingau-Literaturpreis geehrt, und arbeitet auch als Sprecher und Moderator.
Die Kerze hinter der Wand, die Abendsonne hinter den Bergen, die niemand zu sehen vermeint, das ist das, was Du singst, das ist das, was wir hören, wusste Heimbach. Adagio! winkte manchmal die Schwester, und die helle Wiese unter den gemalten Pferden des Bruders wurde schattig und müde und atmete langsam, bis das Dunkel auch das weißeste Pferd verschlang. Malte er, was sie sprach, waren es die Farben ihrer Stimme, die er hörte oder der Geruch ihres Atems, wenn sie schlief.
Flüsterte er, ziemlich laut, aber ohne sie aufzuwecken, dann spürte er das Galoppieren an ihren Schläfen und einen Hauch von Geschwindigkeit in der Art und Weise, wie sie atmete. Heimbach war sich sicher, dieses Tempo im Kopf seiner Schwester auch riechen zu können, so wie er auch die Farben roch und sich stets an die Worte seiner Schwester, sozusagen vom Pferd herab erinnern musste, als sie ihn von Kindesbeinen an fragte: Bist Du nun taub oder blind oder keines von beidem? Die Antwort lag ihm auf der Zunge, auch wenn er die Frage nicht verstand, und seinen Pinsel aus Pferdehaaren in die Hand nahm. Aber nicht nur der Schwester zuliebe, vielleicht auch deshalb, um auf seinen Farben in ihren Schlaf hineinreiten zu können.
Von Kindheit an war seine Schwester darin geübt, mit geschlossenen Augen, ob sie nun schlief oder nicht, ob sie nun ritt oder nicht, das, was ihr Bruder malte, zu riechen: den Duft des edlen Herren in der Sonntagsrüstung, den Gestank des Unterrockes einer Prinzessin, das gebratene Schwein, den gedünsteten Ochsen beim Bankett des Kaisers - und immer wieder, im Hintergrund, aus dem Rahmen gefallen sozusagen, den einen oder anderen Pferdeapfel, umflort vom Schweißgeruch seines Hengstes, dessen Wiehern ihrem Bruder nie zu Ohren gekommen war.
Bei allem, was er malte, spürte Heimbach den Puls seiner Menschen und Tiere. Er wollte so malen, mit Farben und Mustern und Schatten und Licht, dass all diese verschiedenen Pulse nicht nur zu fühlen, sondern auch zu sehen sein sollten. Für ihn war Allegro so etwas wie ein ungehörtes Zauberwort, das er in den dritten Jagdhund von links nach allen Regeln der Kunst hineingemalt hatte.
Schnell oder langsam, gut oder schlecht, tot oder lebendig. Zwischen all dem wollte sich der Bruder seiner Schwester auch erklären. Vor allem in einem Brief wie diesem:
Meine Liebe! Ich weiß nie, ob du zu schnell bist oder zu langsam. Das schnelle Schauen hat sich jedenfalls nicht nur bei den Perückenmachern eingeschlichen.
Wer einen Hasen richtig ansieht, kann ihn schon bloß durch einen gezielten Blick so sehr beschleunigen, dass es das arme Wald- und Wiesentier vor Angst und Ungeduld in der Luft zerreißt. Manchen meiner Kollegen ergeht es ähnlich: Nicht wenige gutsituierte Landschaftsmaler oder Genrepinsler sind unter den strengen Blicken der Schnellschauer zersprungen. Der Sonnenuntergang von Delft mit dem Magenfragment des Vermeer ist ein beredtes Beispiel dafür.
In anderen Landschaften sieht man den Maler höchstselbst in gestrecktem Galopp jenseits des Mittelgrundes vor den ganz schnell Schauenden flüchten, im schlimmsten Fall erfolgt die Explosion dann kurz vor der Horizontlinie, woraus sich die große Rauchentwicklung in den Gemälden erklären lässt.
Seltener, meine Liebe, ist die Implosion des Malers, die zum Beispiel bei Rembrandts Selbstbildnissen einen gewissen nachdenklichen Ausdruck mit sich bringt. Sowohl Implosion als auch Explosion sind die tragischen Folgen des Druckunterschiedes, der sich durch den Kontrast der Sehgeschwindigkeiten schicksalhaft ergibt. Der Maler als Langsamseher, für den die Erfindung der Farben mit einem tiefen Schlaf in untrennbarer Verbindung steht, befindet sich in einem geradezu physikalischen Gegensatz zum Schnellschauer, der den Maler in jeder nur erdenklichen Kurve des Bildes rücksichtslos überholt.
Der Hummer ist noch nicht fertig gepinselt, schon springt der Schnellmaler zur faulen Zitrone, die sich der Maler in seinem bedächtigen Kopf in Geruch und Lasur gerade noch vorstellt; der Maler badet mit seinem Ultramarinpinsel sommermüde im See, während der Passant im Bild bereits den Gipfel erklommen hat.
Zur Implosion kommt es dann, wenn sich der selbstgemalte, aber immerhin fertiggemalte Maler mit seinem schläfrigen Blick (denn das Malen ist stets eine Kunst am Rande des Schlafes) oder der muntere, und eine kurze Hose tragende Schnellschauer in die Augen sehen. In der Begegnung der Blicke mit ihren unterschiedlichen Sehgeschwindigkeiten ergibt sich eine Reibung, die ihrerseits zu elektrischer Ladung führt. Der hochexplosive Zustand des Selbstporträtisten steht somit in einem spannungsreichen Gegensatz zu seiner in Farbe und Lasur gebannten Schwere. Sein Blick, der mit großer Sehnsucht aus der Enge des Bildes die Weite sucht, wird plötzlich nach innen gekehrt und der fatale Kurzschluss lässt nicht mehr länger auf sich warten. So nimmt es nicht wunder, dass der selbstporträtierte Rembrandt in implodiertem Zustand wie ein müder Sack im Bild hängt, während der Schnellschauer mit drahtigen Schritten zum nächsten Bild schreitet. Liebe Schwester, bitte verzeih. Ich bin nicht Rembrandt, aber immerhin Dein Bruder.
Dass sich das Pferd seiner Schwester vor dem hastigen, allzu schnellen Gemaltwerden fürchtete und aus dem Bild galoppierte ist nicht weiter verwunderlich, auch nicht für Heimbachs Schwester. Dass diese von diesem - ihrem - Pferd schon jenseits des Bildes ihres Bruders, nicht nur aus dem Rahmen gefallen war, sondern außerhalb des brüderlichen Bilderrahmens von ihrem Pferd fiel und zu Tode kam, das hatte ihr Bruder weder gesehen noch hätte er es überhaupt wahrnehmen wollen.
Er blieb, mit dem Pinsel, vielleicht gerade deshalb bei der Coloratur des Allegro, das er eher in sich selbst verspürte. Das Tempo, der Puls seiner Schwester war ihm ja abhandengekommen, ohne dass er wissen oder hören konnte, warum.
Diese Frage, und er fragte vor allem mit den Händen, konnte er für sich nur in einem anderen Tempo beantworten, im Körper eines anderen Tieres, eines anderen Pferdes, ohne Reiterin, im Schatten, nicht unbedingt im Schatten des Todes, den er ja auch nicht hören konnte, so wie er das Leben seiner Schwester oder das Wiehern des von ihm gemalten Pferdes nie gehört hatte. Er wählte die Langsamkeit des Pinsels, die Dunkelheit im Schatten der Pferde, die absolute Finsternis der Augen seiner Schwester, den Schein der spärlichen Kerzenleuchter am Hof der Habsburger, die für ihn, den Nordseemenschen, ohnehin nur finstere Gestalten waren und immer mehr zu solchen wurden, je mehr gegessen und beim Essen und beim Reiten geschwiegen wurde. Wobei auch der Tod seiner Schwester beim dritten Pferdeballett verschwiegen worden war. Aber auch dieses Schweigen konnte ihm nicht zu Ohren gekommen sein. Der langsamere Pinselstrich wäre für seine Schwester sicher wohltuender gewesen, und hätte ihr auch das Leben bewahrt, oder wenigstens verlängert. Sie hatte sich und ihr Pferd von seinem Pferdehaarpinsel immer gut verstanden gefühlt, und geradezu mit den Fingern gehört.
Jetzt aber konnte Heimbach nur noch das letzte Pferd malen, das Pferd ohne Schwester, das langsamste Tier, das er jemals in einer Landschaft gesehen oder sichtbar gemacht hatte. Immerhin erschien ihm seine Schwester im Traum und sagte: Lieber Bruder, nichts ist gemalt, nicht einmal wir, auch wenn es das Schönste wäre, einfach nur gemalt zu sein, mit einem schnellen, dem schnellsten oder auch einem langsamen Pinselstrich, der aber die innerliche Geschwindigkeit des Malers nicht verleugnen kann.
Nichts von all dem hatte er notiert, es waren auch keine der Fragen gestellt oder beantwortet worden, bevor seine Schwester verschwand. Sie hatte eines Morgens ihre Hand von seinem Kopf genommen und war gegangen, wie er annehmen musste. Sie war gegangen, um zu reiten.
Doch weit konnte sie nicht sein, das wusste er genau. Er suchte sie nicht, weil er zu hören meinte, wo sie war - in einem seiner schönsten und dunkelsten Bilder, in dem ein kühler Wind wie frischer Atem weht. Der Atem meiner Schwester, meinte der Maler.
Wenn Heimbach nun ein Buch aufschlug, schien es ihm, als könnte er in der geliebten Dunkelheit seiner Schwester blättern. Er zog das Lesen dem Sehen vor. Blättere ich in meiner Schwester oder blättere ich in einem Buch? Regen sich die Wörter, dann sind es die Bewegungen meiner Schwester, die in der Schrift der Sprache so und nicht anders notiert sind.
Seither hielt der Maler gerne Bücher in seinen Händen, er liebte den Geruch des Papiers, denn es war ihr Geruch. Der Tod eines seiner Porträtierten war für Heimbach wie das Verschwinden einer Farbe aus der Landschaft. Immer dünkler wurden seine Bilder, immer langsamer wurden die Farben, denn die Modelle wurden alt, bis Heimbach eines Tages dann seine Finger in die schwärzeste Farbe tauchte, um sein letztes Bild zu malen, in dem noch heute in der Ferne die Stille zu hören ist, in der er sein Leben mit allen lebendigen Farben zugebracht hat. Den galoppierenden, den toten, den schwitzenden, den wütenden, den Farben seiner reitenden Schwester, wie tot oder lebendig sie auch immer sein mochte.