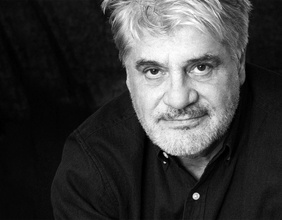ORF/ALEXANDRA MANTLER
Praxis
Rocky Emperor: Rapper aus dem Slum
Korogocho ist der drittgrößte Slum in Nairobi. Die meisten Leute leben von Tagelöhnerjobs oder vom Müllsammeln auf der angrenzenden riesigen Müllhalde. Früher hat sich auch Rocky Emperor hier herumgetrieben, jetzt macht der 16-Jährige seinen Schulabschluss und träumt von einer Musiker-Karriere.
30. Jänner 2021, 12:00
Der Name Korogocho kommt aus der Sprache der Kikuyu und bedeutet so viel wie „Durcheinander, Chaos, Abfall“. In Korogocho leben laut Schätzungen mindestens 150.000 Menschen. Die riesige Müllhalde Dandora grenzt direkt an den Slum.
Müll und Marabus
Riesenhaft und gespenstisch türmt sich hier der Abfall: ein Berg, nur aus weißen Plastikflaschen, grünem Verpackungsmaterial, Matsch, Rauch, ab und zu löst sich aus der schier endlosen Masse da und dort ein Versatzstück, das vielleicht einmal jemandem wichtig war: die schwarze Kinderhandtasche mit Minimausohren und roter Masche, eine einzelne Spielkarte: der Joker.

ORF/ALEXANDRA MANTLER
Immer weiter rollen Lastwagen heran, bringen neuen Müll. Und Menschen, gebückt und eingehüllt in Plastik-Ponchos gegen den Regen, sortieren und suchen. Dazwischen Kühe und Hunde. Und auf den Gipfeln der Müllberge ganze Scharen von riesengroßen schwarz-gefiederten Vögeln: Marabus, so groß wie Menschen.

ORF/ALEXANDRA MANTLER
Unter einem Verschlag aus Wellblech und Plastikplanen wartet die 35-jährige Sipros Atienu das Ende des Regens ab. Sie hat ein gelbes Tuch wie einen Turban um ihre Haare gewickelt und erklärt: „Ich bin hier, weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wir sortieren den Müll und sammeln hier Altpapier, Kartonagen und Plastik.“
Bezahlt wird pro Kilo. Doch die umgerechnet zwei bis vier Euro, die sie so pro Tag verdient, reichen nicht wirklich, um als Alleinerzieherin ihre sechs Kinder ernähren zu können.
Rocky Emperor und die Sisters of Mercy
Nach dem Tod seiner Eltern hat sich auch Felix Ouma als Straßenkind hier herumgetrieben. Nun ist er 16 Jahre alt und macht bald seinen Schulabschluss, hofft die katholische Ordensschwester Mary Killeen. Die gebürtige Irin ist 75 Jahre alt, gehört dem Orden der „Sisters of Mercy“ an und lebt seit über 40 Jahren in Kenia. Sie engagiert sich mit Leib und Seele für Straßenkinder, einst in den Armenvierteln von Dublin und heute in den Slums von Nairobi. Doch Kinder, die sich jahrelang auf der Straße durchgeschlagen haben, wieder zurückzuholen in ein normales Leben mit Schule und Regeln und Schlafenszeiten, das sei auch immer wieder eine Herausforderung.
„Rocky Emperor“, wie sich Felix Ouma heute mit Künstlernamen nennt, habe ihr fast das Herz gebrochen, meint die resolute Ordensfrau. „Er brauchte eine Herzoperation. Danach hat er jemandem das Handy geklaut und ist weggelaufen.“ Krank vor Sorge hätten sie und ihre Mitschwestern die Straßen abgesucht nach dem frisch operierten Burschen. „Wir haben ihn gefunden und wieder zurückgebracht und er ist wieder weggelaufen.“
Zwischen Club und Schule
Doch schließlich hätte sie Rocky Emperor überzeugen können, in die Schule zu gehen. Doch am Abend sei er oft nicht heimgekommen, sondern habe sich stattdessen in den Clubs herumgetrieben und bei DJs gelernt.
„Den Buben kannst Du nicht herinnen halten“, stellt Sister Mary seufzend fest. „Er sagt, da draußen ist die Musik und meine Karriere, also lebt er jetzt bei einem Freund draußen, wir unterstützen ihn mit Essen und - Gott sei Dank - er kommt fast täglich in die Schule und macht bald seinen Abschluss.“
Rocky Emperor tippt auf seinem Handy herum und sucht einen seiner fertig gemischten Songs. „Ich kann singen, ich kann rappen“, erzählt er. „Ich schreibe meine Texte selbst und meine eigene Musik. Ich habe viele HipHop Songs, aber auch Gospel Songs. Denn Gott hat mich schon einen weiten Weg geführt und er wird mich noch weiterführen.“
Armut und Gewalt
Armut, Alkoholismus und Gewalt gehören hier im Slum zwischen den Wellblech-Hüten oft zusammen, erklärt der Sozialarbeiter Beiram Odhiambo. Daran würden auch die meisten Beziehungen zerbrechen.
In vielen Fällen bleibe dann ein Elternteil, meist die Mutter, mit einer Schar von Kindern als Alleinerzieherin zurück. Zu essen gibt es oft nur, was auf der Müllhalde zu finden ist. Frauen und Mädchen stünden jeden Monat vor dem Problem, wie sie die Monatshygiene finanzieren, erklärt Sister Mary.
„Wenn die Mädchen keine ordentlichen Binden haben, kommen sie nicht in die Schule, aus Angst davor, vielleicht einen Blutfleck auf dem Kleid zu haben“, weiß die Ordensfrau, die lange hier Direktorin einer Schule im Slum war. Das gelte hier als große Schande.
100 kenianische Schilling, also rund 1 Euro, kosten die Binden pro Periode. In Familien, die oft nur 3 Euro am Tag verdienen und in denen mehrere Frauen und Mädchen leben, reißen die Ausgaben für die Monatshygiene oft ein tiefes Loch ins spärliche Budget, erzählt auch Millie Akinyi, die sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche in ihrem Slum engagiert: „Wenn ihr die Eltern keine Binden geben können, dann sucht das Mädchen einen Burschen, der ihr 50 oder 100 Schilling gibt, um sich Binden zu kaufen. Aber das muss sie dann zurück zahlen - in Form von Sex.“
Menstruations-Prostitiution
Diese "Menstruations-Prostitution" sei eine der Hauptursachen für die häufigen Teenager-Schwangerschaften hier im Slum, erklärt Millie.
Bei der lokalen Hilfsorganisation Mathare Children's Fund, die auch von der österreichischen Dreikönigsaktion unterstützt wird, rattern gerade die Nähmaschinen. Rosa und blaue Stoffstücke ziehen die Frauen unter dem Nähfuß durch. In vierzehn Arbeitsschritten entstehen hier wiederverwendbare Binden. Im Moment läuft die Produktion auf Hochtouren, denn bald müssen 18.000 Stück in die somalische Hauptstadt Mogadischu geliefert werden: ein Großauftrag einer NGO.
Fünf Binden sind in einer Packung, zwei rosa für die starken Tage, drei blaue für die schwächeren. Ein Paket kostet 400 kenianische Schilling und hält ein ganzes Jahr lang. Die gelernte Modedesignerin Mercy Odero hat sie entworfen: oval mit zwei Druckknöpfen auf den Seitenteilen, damit nichts verrutscht und leicht und diskret im dazugehörigen Täschchen zu verstauen.

ORF/ALEXANDRA MANTLER
Binden statt Tassen
Die Binde wird mit kaltem Wasser gereinigt und muss nicht ausgekocht werden. Darum sei sie bei den Mädchen auch beliebter als Menstruationstassen, sagt die Designerin. Dazu komme: „Saubere und hygienische Toiletten oder gar Badezimmer sind hier im Slum halt Mangelware. Darum ziehen die Mädchen die Binden eindeutig vor“, erklärt Mercy Odero. „Für manche Mädchen ist das wirklich ein Segen, eine Lösung für ihr Problem.“