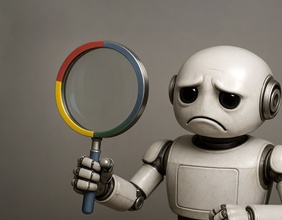ORF/JOSEPH SCHIMMER
Fremdwörter
Abschieben oder fremdgehen?
Sind Fremdwörter in unserer Sprache nun Marken der Abgehobenheit oder Botschafter der Welt? Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Integrieren? Zwangsassimilieren? Abschieben? Mit ihnen fremdgehen...? Allseits wird die Forderung nach allgemeinverständlicher Sprache laut. Aber wer bestimmt, was der Allgemeinverstand ist. Für den Philosophen Theodor Adorno sind Fremdwörter "die Juden der Sprache".
1. April 2021, 12:00
Lord Nylons Schlüsseldienst: Fremdwörter
Mein Einstieg in die Weltliteratur waren die Klassiker der Abenteuerromane - Texte, die in exotischen Erdteilen und auf hoher See spielten. Jedes Kapitel erschloss meiner gierigen Fantasie nicht nur neue Begriffe, sondern auch neue Welten, denn jeder neue Begriff war ein Schlüssel zu einer neuen Welt. Wie gut, dass es da Fußnoten oder ein Glossar gab.
So erschloss ich mir Schiffstypen, Sturmarten, ferne Orte und Kulturen, längst ausgestorbene Wörter wie kujonieren und bastonieren, und lernte, was ein Leesegel ist. Doch wozu beim Klabautermann braucht man wissen, was ein Leesegel ist? Seid ihr verrückt, ihr Narren?, hätte ein halbwüchsiger Lord Nylon euch entgegengerufen, erst die Erfindung dieses Segels verkürzt den Transport eurer Kolonialleckereien nach Bristol um Wochen und macht sie dadurch billiger. Dass deren günstiger Preis vor allem der Sklavenarbeit auf den kolonialen Plantagen geschuldet war, brachten mir weitere Bücher zu Bewusstsein, zum Beispiel die von B. Traven, dem ich verdankte, dass Campesinos, Hacienderos sowie Tierra y Libertad zu meinem Sprachgebrauch wurden. Wäre damals jemand dahergekommen und hätte, damit ich mich nicht so ausgeschlossen fühle, alle neuen Wörter rausgejätet, somit die Kapillargefäße gekappt, durch die das Buch mit Geschichte und weiter Welt verbunden war, ich hätte ihn, ohne zu zögern, kopfüber an die oberste Rahe des Besanmasts geknüpft.
Jeder neue Begriff steuert dem Bewusstsein einen neuen Knotenpunkt assoziativer Vernetzungen bei - erweitert Denken und Fantasie.
Das Individuum unterscheidet vom Zombie, wie autonom oder wie manipulativ sein Sprachbewusstsein sich bildet.
Mit ein bisschen Erfahrung kommt man einem Text sofort auf die Schliche, ob die Verwendung von Fremdwörtern den Sinn vertieft oder bloß Dekor ist. Institutionalisierte Akademiker/innen schmücken sich noch immer mit lateinischen Floskeln wie cum grano salis oder in effigie, die sie ihren Texten wie Wandernadeln anstecken. Von deren Steifheit heben sich lebensfreudigere Uni-Profs gerne mit - oh, là, là - französischen Wendungen ab, bekunden mit einem süffisanten au contraire Weltläufigkeit und Bereitschaft zum gebildeten Seitensprung. Liessmann-Texte etwa konnte man bei intellektuellen Blindverkostungen stets dadurch erkennen, dass ihr Autor darin eine pikante Pointe ankündigte. Mit den Fremdwörtern ist es eben wie mit dem Sextourismus: Irgendwann verflüchtigt sich die Illusion, dass ein Juan, Yannis oder Jean-Philippe interessanter sei als ein Hans, was nicht dazu verpflichten darf, sich nur noch mit Hänsen zu paaren, denn das wäre Sexualrassismus.
Es ist wie mit den leibhaftigen Fremden: Die Fremdwörter sind Sündenböcke für ganz andere Probleme.
Wir können sie assimilieren wie das Malör, indem wir es mit Ö schreiben und damit ihre Vergangenheit tilgen, oder wir können sie abschieben. Doch dann werden wir merken, dass einheimische Ersatzbegriffe nicht besser verstanden werden, weil unsere Fähigkeit zu Abstraktion, zur Welt- und damit auch zur Spracherfahrung verkümmert ist. Denn um uns zu befreien, aus Benachteiligung, aus Bevormundung, aus Verdinglichung, müssen wir uns einen Begriff von der Gesellschaft machen, und dazu reicht unsere Sprache oft nicht hin, denn neue Gedanken brauchen neue Wörter. In den riesigen Lagerhallen voll Theorien und fremden Wörtern, die man von uns fernhält und von denen wir uns fernhalten und die man Akademien nennt, gibt es viel Schrott, aber auch sehr viel Brauchbares zum Verstehen von Gesellschaft, Macht und Verdummung.
Und zum Schluss sei ein spektakuläres Geheimnis gelüftet:
Intellektuelle kommen sich selten besser vor als andere Menschen und gehören meistens auch nicht zum Establishment.
Im Gegenteil, in Öffis flüstern sie ihre Fremdwörter. Und sie verstecken ihre Bildung hinter der Maske des Fußballfans und künstlicher Bodenständigkeit. Kurzum: Sie verwenden bestimmte Begriffe nicht, um andere auszuschließen, sondern weil sie zu ihrer Gewohnheit geworden sind, und so wie es keinen Grund gibt, Sprecher bestimmter Dialekte zu diskriminieren, darf man auch Hirnwichser wegen ihrer Fachsprachen nicht abwerten. Mehr von ihnen, als man glauben möchte, leben prekär, unter anderem weil Leute, die wissen, was repressive Toleranz ist, sicher schlechtere Karten als solche haben, die über Competition Assets verfügen; sie stehen wie andere Menschen in Supermarktschlangen, leiden wie andere auch an Gallenkoliken und freuen sich wie wir, wenn der Frühling kommt.
Im Übrigen halte man es mit Karl Kraus:
Ungewöhnliche Worte zu gebrauchen, ist eine literarische Unart. Man darf dem Publikum bloß gedankliche Schwierigkeiten in den Weg legen.