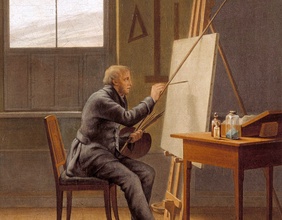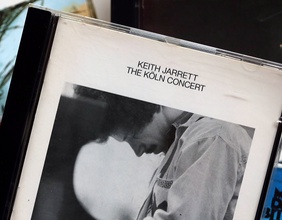AFP/DAMIEN MEYER
Matrix
Wo die Cloud zu Hause ist
„Die Cloud“ in ihrer Erklärung, es handle sich um Rechner an einem anderen Ort, wird der Beschreibung dessen, was Datencenter mittlerweile leisten können, nicht mehr in voller Gänze gerecht. Insbesondere eine damit einhergehende Vorstellung, es ginge rein darum, Daten an einen anderen Ort auszulagern, beschreibt lediglich eines von unzähligen Anwendungsgebieten, die durch Cloud-Lösungen mittlerweile möglich sind.
28. Februar 2021, 02:00
Sendung hören
Matrix | 29 01 2021
Die immer besseren Internetverbindungen, auch im privaten Bereich, haben eine Vielzahl an sogenannten „Cloud Software-Lösungen“ ermöglicht, sodass wir, manchmal ohne, dass es uns bewusst ist, quasi täglich in der Cloud unterwegs sind. Soziale Medien wie Facebook oder Instagram sind nur eines von vielen Beispielen, wo das Service nicht mehr möglich wäre, ohne, dass sich unsere Tablets und Smartphones in die Cloud verbinden.
Jedes zweite Unternehmen nutzt die Cloud
Laut Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG, ist hierzulande bereits jedes zweite Unternehmen ab 20 Mitarbeitern ein Cloud-Nutzer. Ein Drittel der österreichischen Unternehmen nutzt Public Cloud Computing, wo zum Beispiel E-Mail, Speicherplatz, oder Programme für Online-Konferenzen bereitgestellt werden.
Die Marktführer in diesem Bereich kommen aus den USA. Die Namen sind vertraut. Microsoft, Google und Amazon. Allerdings, so die Studie weiter, ginge es längst nicht mehr darum, ob Cloud-Computing genutzt werden soll, sondern wie Cloud-Lösungen in bestehende IT-Systeme integriert werden können. Ohne Cloud gäbe es künftig keine Wettbewerbsfähigkeit.
Datencenter organisieren das Wissen der Welt
Hinter der Cloud stehen Rechenzentren. Sie beherbergen und organisieren das Wissen der Welt; Egal ob es sich um Chatnachrichten, Finanz-Transaktionen, oder Firmeninterna handelt. Im Oktober verkündete Microsoft in Österreich ein Datencenter zu bauen. Kostenpunkt 1 Milliarde Euro. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens IDC, die von Microsoft finanziert wurde, würde die Investition in den nächsten vier Jahren zu einer zusätzlichen gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Höhe von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar führen.
Höhere Geschwindigkeit, bessere Zugänglichkeit, sowie bessere Datenerhaltung; Für Kundinnen und Kunden in Österreich lägen die Vorteile auf der Hand, so Florian Slezak, Manager des künftigen Datencenters. Für Österreich, als eine von künftig weltweit 64 Datencenter-Regionen, bringe das bis zu 29.000 Arbeitsplätze, die entstehen.
Neben eigenen Projekten wie das „Digital Centre of Excellence“, um gemeinsam mit der Bundesregierung die IT-Infrastruktur im öffentlichen Dienst zu modernisieren, will man sich besonders der Förderung von grünen und nachhaltigen Projekten widmen. „Weil uns überall dort, wo wir operieren, und wir sind mit unserem Cloud-Service mittlerweile in über 140 Ländern der Welt vertreten, nicht nur Profit wichtig ist, sondern wir auch nachhaltig zu Ausbildung, zur Gesellschaft, aber auch zum Umweltschutz beitragen wollen.“
Die Geschichte von Microsofts Datencentern
Dass es dem US-Unternehmen möglich ist, ein Datencenter vermeintlich aus dem Boden zu stampfen, ist den über 31 Jahren Erfahrung geschuldet. Jedes gebaute Datencenter dient auch als Forschungsobjekt, um ein noch effizienteres Datencenter für die Zukunft zu entwickeln. Neben Hardware und Software spielt auch die Architektur eine große Rolle.
Der Data Centa Evangelist, Gérard Van der Burg, lädt immer wieder zu Vorträgen und virtuelle Reisen zu den Datencentern des Technologie-Unternehmens. Die Geschichte beginnt im Jahr 1989, wo sich ursprünglich alles um den Eigenbedarf drehte.
„Die Server mussten ständig verfügbar sein und durch Redundanz Ausfälle verhindern. Damit sie nicht überhitzen, war es in diesen Rechenzentren eiskalt. Wenn ich gefragt werde, wie kalt das war, antworte ich zumeist: Ein Tag in so einem Rechenzentrum konnte einem eine einwöchige Verkühlung bescheren“, so Van der Burg.
"Man lädt sie von einem Lastwagen, schließt sie an das Herzstück an, und in ungefähr vier Stunden sind sie auch schon betriebsbereit."
Die Schlüsselerfahrungen dienten als Basis für die nächste Datencenter-Generation. Eines der Hauptziele war, Energieverbrauch und -Kosten zu reduzieren und den vorhandenen Platz optimal auszunutzen. Eine Datencenter-Generation weiter drehte sich alles darum, die Gebäude selbst zu optimieren.
Van der Burg: „Stellen Sie sich einen Schiffscontainer vor. In diesem befinden sich die Racks mit 1500 bis 2500 Servern pro Einheit. Dazu kommt natürlich noch ein Kühlnetzwerk. Im Grunde genommen sprechen wir hier von vorkonfigurierten kleinen Rechenzentren. Man lädt sie von einem Lastwagen, schließt sie an das Herzstück an, und in ungefähr vier Stunden sind sie auch schon betriebsbereit. Das ist sehr effizient.“
Rechnermonster für Rechenzentren
Ab 2015 wurden Datencenter, aber auch der Energieverbrauch opulent. Riesige Anlagen prägten die Bilder der sogenannten „Hyper scale generation“. Auf einem weitläufigen Areal werden etwa vier Datenzentren zu einem zusammengeschlossen. „So ein Datenzentrum benötigte insgesamt 32 Megawatt. Vergleicht man das mit dem Energieverbrauch eines Hauses, so verbraucht ein einzelnes Gebäude des Datencenters die gleiche Energie wie 30.000 Häuser“, erzählt Van der Burg.
Immer im Hinterkopf, Kosten und Energie zu sparen, entwickelte Microsoft kleinere Datencenter, die einige Generationen später, 2019 in „Ballard“ mündeten. Alles wurde vereinfacht und automatisiert. Künstliche Intelligenz überwacht den Stromverbrauch und Software überprüft die Datencenter-Software auf Effizienz.
„Stellen Sie sich kleine Blöcke vor, die man zusammenfügt und die man einfach ans laufende System andockt."
Noch eine Generation weiter prägen kleine Tranchen, vergleichbar mit LEGO-Steinen das Bild.
Van der Burg: „Stellen Sie sich kleine Blöcke vor, die man zusammenfügt und die man einfach ans laufende System andockt. Man wartet nicht darauf, bis eine gesamte Gebäudekonstruktion fertig ist. Sobald das Herzstück, der erste Einsatzbereich, den wir „Compute Room“ nennen, fertig ist, beginnen wir den Betrieb und fügen die zusätzlichen Blöcke an.“
Begleitet wurde die Entwicklung der Datencenter von entsprechenden Rechnern. Ihre Namen, wie etwa „Godzilla“, oder Beast“, veranschaulichen, dass man, um ein Rechenzentrum zu betreiben auch Rechnermonster benötigt.
Licht, Wasser, Weltraum: Die Zukunft der Datencenter
Parallel zu den Umsetzungen laufen die Forschungen, um das Datencenter der Zukunft zu planen. Im „Project Natick“ dreht sich alles um Datencenter auf, oder unter Wasser. Eigene Teams befassen sich mit den optischen Möglichkeiten, um die Glasfaser-Verbindungen zu optimieren.
Van der Burg: „Stellen Sie sich einen einzelnen Lichtstrahl vor, der sich in mehrere Farben aufteilt. Diese Farben stehen für die Kapazität. Man kann also die Kapazität erhöhen, indem man die gleiche Infrastruktur verwendet, aber sie in verschiedene Farben aufteilt. Und genau das haben wir getan.“ Die Ankündigung, die Cloud auch ins Weltall zu bringen, folgte vergangenes Jahr. Hinter „Azure Space“ stehen mehrere Produkte und Partnerschaften, unter anderem mit SpaceX, um sich auch im weltraum- und satellitenbezogenen Cloudmarkt zu positionieren.
Gestaltung: Sarah Kriesche