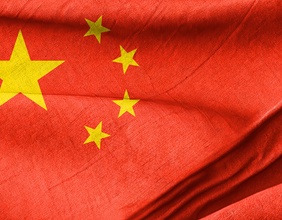APA/ROLAND SCHLAGER
Dimensionen
Zufall in der Wissenschaft
Die Liste an Entdeckungen, die dem Zufall zu verdanken sind, ist lang. Die Entdeckung von Penicillin gehört beispielsweise dazu. Der schottische Bakteriologe Alexander Fleming lässt seine Staphylokokken-Kulturen offen im Labor stehen und fährt auf Urlaub. Als er zurückkommt, entdeckt er, dass zufällig hineingeratene Schimmelpilze der Gattung Penicillium notatum die Bakterien getötet haben. Solche überraschenden Entdeckungen, auf die eine korrekte Erklärung folgt, werden als Serendipität bezeichnet.
30. Dezember 2021, 02:00
Das Kozept der Serendipität wurde in die Wissenschaftsforschung von dem Soziologen Robert Merton eingeführt. Serendipität, so meinte er, beschreibe die zufällige Entdeckung eines theoretisch vorbereiteten Geistes, die zu Erkenntnissen führt, mit denen man nicht gerechnet hat.
Ursprünglich stammt der Begriff Serendipität aus dem 18. Jahrhundert. Der britische Autor Horace Walpole hat ihn verwendet, um einem Freund einen Zufallsfund zu schildern. Entlehnt hat er ihn dem persischen Märchen: „Die drei Prinzen von Serendip“. In dieser Geschichte finden drei Königskinder auf Grund ihrer ausgeprägten Beobachtungsgabe und ihres Scharfsinns Dinge, die sie gar nicht gesucht hatten.
"Seit wach, folgt manchmal eurer Intuition und der Rest ist dann Zufall und das ist Serendipität.“ Helga Nowotny, Wissenschaftsforscherin
Hinter dem Serendipitätsprinzip verbirgt sich mehr als nur glücklicher Zufall. Es braucht auch Fleiß, Forschergeist und den Freiraum Unerwartetem nachzugehen zu können. Forscherinnen und Forscher müssen den Zufall, der ihnen immer wieder im Forschungsalltag begegnet, auch für sich zu nutzen wissen.
Wie man das am Besten macht, dafür gebe es leider kein Erfolgsrezept, sagt Helga Nowotny, emeritierte Professorin der ETH Zürich und frühere Präsidentin des Europäischen Forschungsrates. Man müsse zufälligen Ereignissen nachgehen, dürfe sich dabei aber auch nicht verbohren und in eine Sackgasse verirren. „Dafür gibt es kein Rezept. Außer: Seit wach, folgt manchmal eurer Intuition und der Rest ist dann Zufall und das ist Serendipität.“
"Zufall und Intuition sind letztlich sehr prekäre Instrumente in der Wissenschaft, wiewohl es ohne beide nicht geht.“ Christian Bachhiesl, Wissenschaftshistoriker
Zufall und Intuition sind wichtige Verbündete in der Grundlagenforschung. Sie stehen oft am Beginn eines Forschungsprozesses. In der Wissenschaft sind sie dennoch nicht allzu gern gesehen. Zwar brauche man sowohl Intuition als auch Zufall in der Wissenschaft, doch sie sind nicht verfügbar, man kann sei nicht erzwingen; nicht einfach darauf zugreifen, wenn man sie braucht, erklärt der Historiker und Jurist Christian Bachhiesl von der Universität Graz: „Diese Verfügbarkeit, wie das in der Erkenntnistheorie gerne genannt wird, die ist ja beim Zufall nicht gegeben und auch nicht bei der Intuition. Und das macht Zufall und Intuition letztlich zu einem sehr prekären Instrument in der Wissenschaft, wiewohl es ohne beide nicht geht.“
Zufall und Intuition spielen in Forschung und Wissenschaft eine Rolle. Das zeigen viele Beispiele. Die zufällige Entdeckung der Röntgenstrahlung, ebenso wie die unabsichtliche Vulkanisierung von Gummi. Statt Serendipität zu negieren, sollte man einen aktiven Umgang mit ihr anstreben. Man könne die Fähigkeit Zufälle gut zu verarbeiten fördern, ist Christian Bachhiesl überzeugt. „Sie können offen dafür sein und es können Strukturen geschaffen werden, die überhaupt erst möglich machen, dass solche Zufälle auftreten.“ Strukturen, die Freiraum geben, einer unerwarteten Entdeckung auch nachgehen zu können, sagt Helga Nowotny. Rahmenbedingungen, die in der Forschung nicht selbstverständlich sind. Meist sind Zeit und Ressourcen begrenzt. Und bereits im Forschungsförderungsantrag müssen Ergebnis und Wirkung definiert werden.
Einengung sei in der Forschung zwar etwas Positives, betont die Wissenschaftsforscherin. Ohne Einengung komme man nicht weiter. Gleichzeitig brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch die Möglichkeit, ihre Pläne im Laufe des Forschungsprozesses abändern zu können. Denn das Unerwartete kann immer passieren.