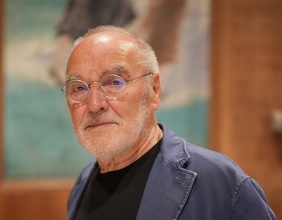PICTUREDESK.COM
Berichterstattung über das Massaker von Graz
Ein Medien-Versagen mit Anlauf
Nach dem Amoklauf in Graz haben vor allem die Boulevard-Medien in ihrer Berichterstattung jeden Skrupel vermissen lassen. Die Folge ist eine neue Debatte über medienethische Standards. Fachleute und Betroffene werden nicht müde, eine sorgsame Berichterstattung einzufordern. Der Presserat und die Medienbehörde haben viel Arbeit, die Politik reagiert sogar mit einem Runden Tisch. Doch die Einsicht bei den Medien-Verantwortlichen hält sich in Grenzen.
2. August 2025, 02:00
Videos von Schülerinnen und Schülern auf der Flucht, untermalt mit dramatischer Musik. Bilder von abgedeckten toten Körpern, psychologisierende Abhandlungen über den Täter, auf einer Doppelseite in der größten Zeitung des Landes. Foto-Montagen, die den Täter kniend neben einer Gedenkstätte für die Opfer platzieren, ganz so, als würde er dort triumphieren. Kein Tabu, vor dem man zurückgeschreckt wäre. Keine Regel, die nicht gebrochen worden ist.
Der Boulevard bricht alle Regeln
Die Berichterstattung über den Amoklauf am 10. Juni an einer Grazer Schule hat vor allem Boulevardmedien wie das Gratis-Blatt "Österreich", der reichweitenstarken "Kronen Zeitung" und den rechtsextremen Kanal "AUF1" in den Fokus der Kritik gerückt. Der Kommunikationswissenschafter Jakob-Moritz Eberl von der Uni Wien hat sich die Berichterstattung rund um Graz angesehen und kommt zu dem Schluss, dass Boulevardmedien den Namen des Täters tatsächlich viel öfter genannt haben als Qualitätsmedien. Beim Presserat sind rund hundert Beschwerden eingelangt, mehrere Verfahren werden eingeleitet. Ergebnisse gibt es erst nach dem Sommer.
"profil" klopft daheim beim Täter an
Auch einige Qualitätsmedien sind in die Kritik geraten. "Mit Ruhm bekleckert hat sich die gesamte Branche nicht", sagt Eberl. So hat das Nachrichtenmagazin "profil" noch am Tag der Tat eine Reportage von der Siedlung, in der der Täter gewohnt hat, veröffentlicht. "Daheim beim Amokläufer", lautete der Titel, der viel Empörung ausgelöst hat – auch weil die Reporter sogar bei der Mutter des Täters geklingelt haben. "profil"-Geschäftsführer Richard Grasl verteidigt die Vorgehensweise und betont: "Das 'profil' hat schnell reagiert und das Umfeld aufgesucht, in dem der Attentäter gelebt hat und einen Bericht darüber gemacht. Vielleicht ist das Einigen ein wenig zu boulevardesk. Ich glaube aber, es ist durchaus legitim und es würden Magazine in anderen Ländern genauso machen."

ORF/URSULA HUMMEL-BERGER
"Krone" macht Furor zur Gewissensfrage
Auch "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann hat Kritik an der reißerischen Berichterstattung seines Blattes und an der Veröffentlichung von Videos aus der Schule in einem Kommentar zurückgewiesen. Es bestehe ein Interesse der Öffentlichkeit daran, zu erfahren, wer und was hinter der Tat stecke. "Letztlich muss vor allem das Gewissen entscheiden", so Herrmann.
ORF-Chefredakteur für mehr Zurückhaltung
ORF-Sendungs-Chefredakteur Johannes Bruckenberger ruft zu mehr Zurückhaltung auf. Man dürfe sich vom Druck durch die sozialen Medien nicht hetzen lassen. Trotzdem passierten Fehler, gerade in hektischen Nachrichtenlagen wie diesen. In einem Bericht der "Zeit im Bild" war kurz die Wohnadresse des Täters zu sehen, später ist die Passage aus dem Netz genommen worden. Kritisiert wurde auch, dass der ORF in den Tagen nach der Tat vor der Schule in Graz Interviews geführt hat. Bruckenberger betont: "Unsere Reporter sind da mit sehr großer Sorgfalt und Behutsamkeit vorgegangen, und nur Personen, die auch unbedingt reden wollten, wurden interviewt."
Die Medien als unfreiwillige Komplizen
Gisela Mayer, Psychologin und Ethikerin, warnt vor den Folgen unbedachter Medien-Interaktionen für Angehörige und Zeugen. Mayer weiß, wovon sie spricht. Ihre Tochter unterrichtete an der Albertville-Realschule in Winnenden in Baden-Württemberg. 2009 tötete dort ein 17-Jähriger fünfzehn Menschen bei einem Amoklauf. Gisela Mayers Tochter war eines der Opfer. Mayer betont: "Ich kenne viele Eltern von getöteten Kindern in Winnenden. Das sind ja keine Medienprofis. Das sind ganz normale Bürger, die sehr viel später noch sehr darunter gelitten haben, dass sie in Situationen gefilmt, interviewt und einer Öffentlichkeit präsentiert wurden, in denen sie einfach weder Herr ihrer selbst noch Herr der Lage waren."
Workshops für überforderte Redaktionen
Mayer setzt sich auch deshalb für eine verantwortungsvolle Berichterstattung ein und gibt Workshops in Redaktionen wie der Süddeutschen Zeitung. Viele Journalisten seien im Umgang mit solchen Tragödien schlicht unwissend und überfordert, glaubt Mayer. Medien sind bei Amok-Taten Teil des Spiels, sagt Mayer. "Dem Täter geht es grundsätzlich um mediale Aufmerksamkeit. Es geht gar nicht um die Opfer. Es geht darum, in der Presse zu sein, auf den Titelseiten zu sein, einmal im Leben berühmt zu sein. Das ist die Motivation. Und Medien, wenn sie sich dem Täter zuwenden, leisten sozusagen kostenlos PR für ihn. Sie tun genau das, was er möchte." Die Faszination für den Täter könne sie psychologisch nachvollziehen, gefährlich ist sie trotzdem.
Die Gefahr der Nachahmung reduzieren
Auch der Suizidforscher Benedikt Till von der MedUni Wien weist auf die Gefahr hin, dass reißerische Berichterstattung Nachahmungstäter animieren könnte. Till hat gemeinsam mit internationalen Experten einen Leitfaden für die Berichterstattung über "Mass Shootings" entwickelt. Dieser Leitfaden empfiehlt unter anderem, den Namen des Täters nicht ständig zu nennen und keine grausamen Bilder des Tatorts zu zeigen.
Halten sich Medien zurück und verhalten sich tatsächlich verantwortungsvoll, dann kann das Positives bewirken. Das zeige nicht zuletzt ein Blick zurück. In den 1980er Jahren habe man Medienschaffende sensibilisieren können, nicht mehr über U-Bahn-Suizide zu berichten. Mit Erfolg. Nicht nur Suizide auf U-Bahn-Gleisen in Wien sind zurückgegangen, sondern die Suizid-Rate allgemein. Es waren die ersten Regeln zur Berichterstattung über Suizide weltweit, sagt Benedikt Till von der MedUni Wien.
Die politischen Mühlen mahlen
Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat diese Woche zu einem ersten Runden Tisch zur Berichterstattung über das Massaker in Graz geladen. Teilgenommen haben Fachleute aus Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Unter dem Titel "Forum Medienverantwortung" soll im Herbst ein zweites Treffen stattfinden. Dann sollen auch politische Konsequenzen und gesetzliche Verschärfungen auf den Weg gebracht werden. Details sind noch offen. Kommunikations-Wissenschafter Jakob Moritz-Eberl schlägt vor, Medienförderungen und Inserate an medienethische Standards zu knüpfen, um Verstöße zu sanktionieren. Den Geldhahn zudrehen – diese Sprache würden wohl alle verstehen.