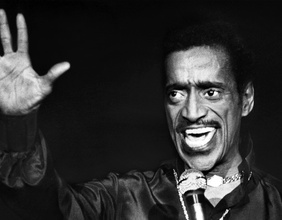PICTUREDESK.COM/ROBERT KALB
Dimensionen
Baukulturerbe Kellergasse
Weinkeller und die Kellergassen, in denen sie liegen, sind Zeugen der jahrhundertelangen Weinbautradition Ostösterreichs. Die Kellertrift, wie sie auch genannt wird, ist untrennbar mit der bäuerlichen Kultur und Wirtschaftsweise des Weinviertels verknüpft. Oft werden Kellergassen auch als "Dorf neben dem Dorf" oder als "Dörfer ohne Rauchfang" bezeichnet.
30. Oktober 2025, 02:00
Sendung hören
Dimensionen | 30 09 2025
In der großen Kellertrift in Haugsdorf im nördlichen Weinviertel betreibt Anna Schöfmann gemeinsam mit ihrem Bruder Weinbau im Nebenerwerb, seit der Großvater dem jungen Geschwisterpaar den alten Weinkeller geschenkt hat. Das „Back to the roots“ im Weinkeller hat für Anna Schöfmann besondere Bedeutung. Hier Wein herzustellen sei eine bewusste Entscheidung, die auch für die Konsument:innen relevant sei, wie sie betont: „Kauf ich ein Produkt, das industriell produziert worden ist, oder eines, das handwerklich hergestellt wurde? Man schmeckt ja auch einen Unterschied, ob man etwas im Supermarkt kauft oder im Bauernladen“.
Ideale Voraussetzung für die Errichtung einer Kellerröhre ist der weiche Lösslehm, der gleichzeitig stabil genug ist, um auch ohne gemauertes Gewölbe zu halten. Neben dem Weinviertel, wo sehr viel Löss angeweht wurde, finden sich auch entlang der Donau bis nach Carnuntum und ins Nordburgenland Weinkeller. In Ungarn, in der Westslowakei und in Südmähren wurden ebenfalls Weinkeller gegraben.
Eigenbauwein ohne Lizenz ausschenken
Ihre Entstehung ist eng verbunden mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen ab dem 17. Jahrhundert, als die Landbevölkerung begann, in Eigenregie Weinbau zu betreiben. Eine wesentliche Veränderung brachte dann die Erlaubnis, Eigenbauwein im eigenen Haus ohne besondere Lizenz auszuschenken, die auf die Liberalisierungen zur Zeit von Kaiser Joseph II. zurückgeht. Weinkeller und Kellergassen sind so gesehen auch ein Stück weit Manifestationen der bäuerlichen Emanzipation von der feudalen Herrschaft.
Orte des sozialen Miteinanders
Kellergassen wurden traditionell in der Nähe der Weinberge und entlang der Zugangswege angelegt. Damit blieben die Transportwege kurz. Hier war es für die Winzerinnen und Winzer außerdem möglich, den Wein an regionale Händler zu verkaufen, die mit ihren Wagen bis zum Keller vorfahren konnten. Manche Kellergassen befinden sich nur wenige Meter, manche mehrere Kilometer von den Ortskernen entfernt. Manchmal steht nur ein einziger Keller auf einem Hügel unter alten Bäumen, wie ein heidnisches Heiligtum. Meist aber ziehen sich die Kellergassen, die stets in Einklang mit der Kulturlandschaft stehen, in Reihen durch die Landschaft. Sie befinden sich an Geländekanten, sie schmiegen sich in Hohlwege, gruppieren sich zu Kellervierteln oder umringen Kellerberge. Die längste Kellergasse führt vom Ort Hadres mehr als eineinhalb Kilometer weit auf eine Anhöhe.
Kellergassen sind seit jeher Orte des sozialen Miteinanders. Kellergassenfeste, Konzerte und Lesungen in Kellergassen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

PICTUREDESK.COM/FRANZ NEUMAYR
Revival der Kellergasse
Dass in Zeiten der Umwelt- und Klimakrise eine Rückbesinnung auf diese ressourcenschonende bäuerliche Architektur stattfindet, ist durchaus begrüßenswert, wie auch Michael Staribacher betont. Er ist beim Land Niederösterreich für die Betreuung und den Erhalt der Kellergassen zuständig: „In der Kellerröhre ist keinerlei Energieeinsatz notwendig, anders als bei einer Halle, die ich für die Weinproduktion in die grüne Wiese stelle.“ Der ökologische Fußabdruck ist in einer Kellerröhre natürlich weitaus geringer als in einer Lagerhalle, wo frisch produziert wird und wo die Klimaanlagen laufen müssen.
Form follows function: Weinkeller sind Zeugnisse schlichter Selfmade-Architektur inmitten der Natur - sie sind Teil einer subsistenzorientierten bäuerlichen Kultur, die mehr und mehr zu verschwinden droht. Umso erfreulicher ist es, dass ein Revival der Kellergasse zu beobachten ist.
Gestaltung: Alexander Behr