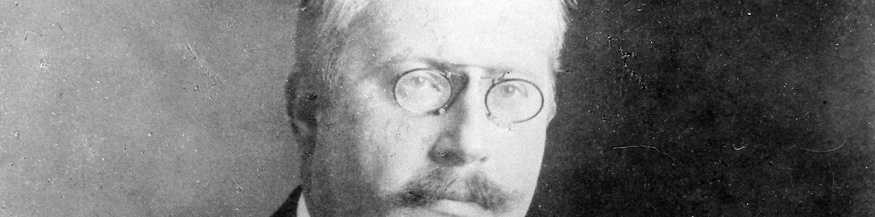Sound Art: Zeit-Ton
"I Am Your Body" von Marco Donnarumma
30. November 2025, 02:00
MUSIK Ex Silens
Marco Donnarumma: Ja, auch gehörlose Menschen erleben Klang. Das ist ein so dummes Stereotyp zu denken, dass gehörlose Menschen keine Klänge hören, dass ihnen diese Welt komplett fremd ist. Das ist einfach nicht wahr. Ja, es stimmt, dass manche Gehörlose kein Interesse daran haben, Klang mit ihren Ohren zu hören, so wie das die Hörenden tun, und das ist auch ihr gutes Recht. Aber nichtsdestotrotz erleben sie Klang, wenn auch auf andere Art. Das Klangwellen Vibrationen auslösen ist allgemein bekannt. Aber Gehörlose kennen noch viel haptischere Erfahrungen, die sehr subtil sein können. Das beobachte ich auch an mir selbst. Je mehr mein cochleäres Hörvermögen abnimmt, umso intensiver wird die ganzkörperliche Erfahrung von Klang. Personen, die gehörlos geboren wurden, leben in einer ganz anderen Welt, die total spannend ist. Klang kann auch visuell sein. Man kann Klang sehen, ohne ihn gleichzeitig hören zu müssen. Denken Sie etwa an Blätter eines Baumes oder an die Ähren eines Kornfeldes, wenn sie sich im Wind bewegen. Klang kann auch Licht sein, Beispiele dafür sind etwa sich nähernde Autos oder der Donner, der auf den Blitz folgt. Ich bin gespannt darauf, all diese verschiedenen Arten Klang und Musik zu erleben und zu verstehen, nun zu erforschen.
MUSIK Ex Silens
Die Performance „Ex Silens“ von Marco Donnarumma beim diesjährigen ORF Festival musikprotokoll im steirischen herbst begann mit einem mächtigen Wummern, das deutlich spürbar den ganzen Körper in Vibration versetzte, die durch den Raum wogenden Basswellen schienen einen vollständig zu durchdringen. Obwohl die Musik eigentlich nicht laut war, hielten sich manche Besucherinnen und Besucher reflexartig die Ohren zu, der Klang bahnte sich trotzdem seinen Weg und machte unmittelbar bewusst, dass Musik eben weit mehr ist, als jene Reize, die durch unsere Ohren in unser Gehirn gelangen und auf die wir in der Regel unsere Aufmerksamkeit lenken. Hier spürte man plötzlich deutlich, dass Hören eine ganzkörperliche Erfahrung ist. Susanna Niedermayr begrüßt Sie ganz herzlich zum heutigen Zeit-Ton.
MUSIK Ex Silens
„regel:bruch“ lautete heuer das Motto des ORF musikprotokoll im steirischen herbst. Seit jeher haben Menschen versucht, Klang zu fassen, sie haben unzählige Ordnungssysteme erfunden, um Klang gestalten zu können; Ordnungssysteme, die von anderen Musikschaffenden vielleicht auch in Frage gestellt wurden, die daraufhin ihre eigenen Systematiken entwickelt haben. Was allen gemeinsam ist: Klang und Musik wurde stets aus der Perspektive der Hörenden betrachtet und diese Perspektive wurde zur Norm erhoben. Wir wollten wissen, wie schwerhörige und gehörlose Menschen Musik wahrnehmen, eine Frage, auf die uns bereits 2020 Marco Donnarumma gebracht hat, als er im Rahmen eines Kompositionsauftrages des musikprotokolls zum ersten Mal ein Stück geschaffen hat, das die Gehörlosigkeit in den Mittelpunkt rückt; die Gehörlosigkeit im Allgemeinen und seine eigene Schwerhörigkeit im Speziellen. Marco Donnarumma ist spätertaubt, seine Hörfähigkeit nimmt sukzessive immer mehr ab.
MUSIK Ex Silens
Die Performance „Ex Silens“ von Marco Donnarumma ist Teil eines größeren Projektes, das den Titel „I Am Your Body“ trägt und sich sowohl an ein schwerhöriges und gehörloses als auch an ein hörendes Publikum wendet. Um zu verstehen, wie es entstanden ist und welche Intention dahintersteckt, tauchen wir ein in die spannende Biographie dieses in so vielerlei Hinsicht beeindruckenden Künstlers. Marco Donnarumma wurde 1984 in Italien geboren. Als Teenager fing er an IDM – elektronische Club Musik – zu produzieren und bereits damals war seine musikalische Arbeit geprägt von einem starken gesellschaftspolitischen Engagement. Zu jener Zeit lebte Donnarumma in Milan.
Marco Donnarumma: Es ging um die Frage, auf welchen Werten wir unser gesellschaftliches Zusammenleben aufbauen wollen. Zentral war dabei immer ein Engagement für den Antifaschismus, für das Recht auf Wohnraum und für Menschen, die benachteiligt waren, wie etwa Immigrantinnen und Immigranten oder Flüchtlinge. Diese Probleme gibt es heute – nach 20 Jahren – immer noch, sie sind nur größer geworden. So bin ich also aufgewachsen, die meiste Zeit war ich in anarchistischen Kreisen unterwegs. Dort habe ich begonnen ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, - auf der Straße, in der Nachbarschaft. Und ich habe Musik gemacht, die dann während der Proteste gespielt wurde. Natürlich hat man als Teenager noch kein komplettes Bild, man versteht noch nicht alle Zusammenhänge, aber man hat vielleicht eine Intuition. In jedem Fall war es mir wichtig, dieses politische Bewusstsein auch in meine künstlerische Arbeit einfließen zu lassen.
Während seines Kunststudiums in Milan und Venedig lernte Marco Donnarumma Klangkunst kennen. Er begann sich mit Soundscape Studies zu beschäftigen, und mit Max MSP und Pure Data. Und er konzipierte erste audiovisuelle Performances. Dabei trat Donnarumma oft mit einer Bassgitarre auf, wobei er diese gerne dazu benutzte, um elektronische Sounds und Visuals anzusteuern. In Lettland tauchte der junge Künstler daraufhin in die Welt des japanischen Butoh-Tanzes ein. Er interessierte sich aber auch die feministische Performance-Kunst, etwa die frühe Arbeit von Marina Abramovic.
Marco Donnarumma: In ihren frühen Jahren hat Marina Abramovic einige wirklich radikale Arbeiten geschaffen, die die Grenze des Möglichen ausgedehnt haben. Aber auch Orlan fand ich sehr inspirierend. Im Rahmen einer ihrer Werkreihen hat sie sich unters Messer gelegt, ihren Körper modifizieren lassen, um einen kritischen Diskurs über weibliche Schönheitsideale anzustoßen.
Nachdem er in Italien seinen Bachelor in „New Technologies for the Performing Arts“ gemacht hat, ging Marco Donnarumma nach England, wo er am Edinburgh Collage of Art ein Masterstudium in Sound Design abschloss. In diesem Rahmen entwickelte er Xth Sense, das auch heute noch sein Hauptinstrument ist. Wie bereits vorhin angesprochen, spielte Donnarumma auch Bass, wobei er mit seiner Bassgitarre gerne elektronische Sounds und Visuals ansteuerte, dafür hat sich der Künstler ein eigenes Computerprogramm geschrieben. Mit der Zeit wünschte sich Donnarumma eine noch direktere Interaktionsmöglichkeit.
Marco Donnarumma: Und dann habe ich während eines Gesprächs gesagt: Vielleicht produzieren Muskelbewegungen ja auch Klänge! Daraufhin habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass dem tatsächlich so ist. Das war der Beginn meines Interesses an der Physiologie des Körpers und der Biomechanik. Der Sensor, der bei Xth Sense zum Einsatz gelangt, wird vor allem in der Medizin verwendet, etwa für den Bau von Prothesen, die mit den Muskelklängen arbeiten. Ich habe ihn zweckentfremdet und in meinem tragbaren Musikinstrument verbaut. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich Xth Sense bei einer Linux Audio Konferenz vorgestellt habe, das war mein erster akademischer Beitrag.
Längst ist Marco Donnarumma, der nach seinem Masterstudium weiters am Goldsmiths der University of London einen Doktor in „performing arts, computing and body theory“ machte, nicht zuletzt auch ein gefragter Theoretiker. Aber schauen wir uns Xth Sense noch ein wenig genauer an. Der Sensor den Marco Donnarumma an einem Gurt mit Klettverschluss befestigt hat, so dass man ihn sich um verschiedene Körperteile schnallen kann, nimmt also Muskelklänge auf, konkret die Klänge der Muskelkontraktionen. Ein anschauliches Beispiel sei der Herzschlag, erklärt der Künstler, der durch das rhythmische Zusammenziehen des Herzmuskels entsteht. Die Muskelklänge werden an einen Computer gesendet.
Marco Donnarumma hat eine Software geschrieben, mit der die Klänge, die die Muskeln produzieren, in Echtzeit analysiert werden können, um bestimmte Bewegungen mit bestimmten Klangeigenschaften zu verknüpfen. Es sei wie bei der Gitarre, die an ein Effektpedal angeschlossen ist, nur das hier das Instrument nicht die Gitarre ist, sondern der eigene Körper. Mit gezielten Muskelbewegungen können die jeweils gewünschten Klänge erzeugt werden.
Marco Donnarumma schnallt sich Xth Sense um seinen Unterarm.
Die Lautstärke, schildert der Künstler, wird durch die Energie gesteuert, die er in die jeweilige Muskelbewegung steckt.
Im Laufe der Jahre hat Marco Donnarumma auch unter zur Hilfe Name von Machine Learning Algorithmen die Analysefähigkeit von Xth Sense immer mehr verfeinert. Alles ist Open Source, mittlerweile verwenden auch zahlreiche andere Künstlerinnen und Künstler Donnarummas biophysikalische Instrument. Während seiner eigenen Auftritte spielt Donnarumma meist zwei Xth Sense gleichzeitig, so auch beim musikprotokoll, im Rahmen von „Ex Silens“, dem Performance-Stück der Reihe „I Am Your Body“, das im Grazer Dom im Berg zu erleben war. Hier ein weiterer Ausschnitt. INTERN
Als er Xth Sense geschaffen hat, hätte er noch wie ein Musiker gedacht, so Marco Donnarumma. Er komponierte mehrere Stücke für gestische Musik, wobei er seinen Körper und die Sounds, die dieser produzierte, immer besser kennenlernte. Und dann fragte sich Donnarumma, ob es denn nicht vielleicht spannend wäre, wenn er die Konzertbesucherinnen und -besucher selbst in die Rolle der Musikschaffenden schlüpfen lässt; wenn diese selbst mit den Klängen ihrer eigenen Körper performen. Das war der ursprüngliche Gedanke hinter „Nigredo“, einer Installation, die schließlich noch viel mehr Fragen aufwerfen sollte, wie sich herausstellte. Beim ORF musikprotokoll haben wir „Nigredo“ 2015 präsentiert. Im Kunsthaus Graz installierte Marco Donnarumma eine kleine, schwarz ausgekleidete Kabine, gerade mal ein mal ein Meter groß. Nachdem man Xth Sense um den Brustkorb geschnallt bekommen hatte, sodass Donnarummas biophysikalisches Instrument den Herzschlag einfing, nahm man auf einem Sessel Platz, in den zwei große Transducer eingebaut waren, einer befand sich in der Sitzfläche, der zweite in der Rückenlehne, auf der Höhe des Hinterkopfs. Ein Transducer ist ein Schallwandler, der Klänge in Vibration übersetzt. Alleine in der Dunkelheit wurde man nun zum Gestalter einer achtminütigen Komposition, die auf den Sounds des eigenen Körpers aufbaute.
Marco Donnarumma: Ein technologisches System fängt also Ihren Herzschlag und auch noch anderen Klänge, die Ihr Körper produziert, ein, und schafft daraus einen achtminütigen Soundtrack, der via Lautsprecher und Subwoofer in die Kabine zurückgespielt wird. Ihre Körper-Sounds steuern weiters das Licht und sie schallen förmlich in ihren Körper hinein, über die sehr großen Transducer, die im Sessel verbaut sind. Sie halten auch einen Transducer in der Hand. Am Anfang stand also die Frage, ob man das Publikum zu Musikerinnen und Musikern machen kann, doch dann entwickelte sich diese Arbeit zu einer recht herausfordernden Studie über die menschliche Wahrnehmung. Im Wesentlichen spannt „Nigredo“ den Besucher, die Besucherin in eine Feedbackschleife mit sich selbst ein, im Wortsinn, durch Klang. Das führt zu sehr interessanten Halluzinationen. Man hat zum Beispiel das Gefühl zu fallen, obwohl man sitzt. Oder man sieht plötzlich verschwommen, weil die Augäpfel zu vibrieren beginnen. Das ist alles ungefährlich, ich verletze niemanden. Aber es sind sehr starke Erfahrungen.
MUSIK Nigredo
Es war seine Partnerin, die Marco Donnarumma darauf aufmerksam gemacht hat, dass er offenbar nicht gut hörte. Erst rund zwei Jahre, nachdem der Künstler das erste Mal zum HNO-Arzt gegangen war, erhielt er eine Diagnose und sie war im ersten Moment niederschmetternd. Eine sensorineurale Schwerhörigkeit, erklärte man ihm, wird dazu führen, dass er mit der Zeit immer schlechter hören wird, bis er schließlich gehörlos ist.
Marco Donnarumma: Meine erste Reaktion als eine Person, die in der hörenden Welt aufgewachsen ist und nichts über Gehörlosigkeit wusste, war: Oh mein Gott, was soll ich nun mit meinem Leben machen? Ich bin ein Klangkünstler, der mit Sound arbeitet. Das war hart und herausfordernd. Es dauerte mehrere Jahre, bis ich meinen Weg gefunden habe. Aber die künstlerische Arbeit, die ich bis dahin gemacht habe, all die Projekte, haben mir dabei geholfen, meine Perspektive zu verändern. Nach der ersten Panik habe ich mir also gesagt: Ich kann Klang noch immer auf viele verschiedene Arten wahrnehmen, also kann ich auch künstlerisch damit arbeiten. Ich habe einen Weg, ich gehe mit meinen Projekten auf Tour, alles ist gut. Das Einzige, was ich verändern muss, ist die Art und Weise, wie ich Sound und Musik verstehe.
Die Liebe zur Bassmusik, die Entwicklung von Xth Sense, seines biophysikalischen Instruments, das Marco Donnarumma auch als Prothese betrachtet, das Interesse an einer Klangerfahrung, die über das Hören mit den Ohren hinausreicht, - aus all dem ließ sich ein roter Faden spinnen, der dem Künstler einen Weg aufzeigte, der von der Vergangenheit in die Zukunft führte. Donnarumma begann in die Gehörlosen-Kultur einzutauchen.
Marco Donnarumma: Ich habe nicht gleich zum Thema Gehörlosigkeit gearbeitet. Ich fand das sehr schwierig, als jemand, der nicht behindert aufgewachsen ist. Ich hatte und habe noch immer viele Privilegien, die Menschen, die von Geburt an gehörlos sind, nicht haben. Oder die eine andere Behinderung haben, die ich nicht habe. Ich konnte nicht sagen: Gut, dann arbeite ich jetzt zum Thema Gehörlosigkeit, das hätte sich zu berufen angefühlt. Also habe ich einfach gewartet, bis ich eine Idee hatte, die gut genug war.
„Inanis“ sollte dieses Projekt heißen. Es entstand im Rahmen eines Kompositionsauftrages des ORF musikprotokolls, für das Projekt „Tingles and Clicks“, mehr dazu gleich. In den fünf Jahren bis dahin arbeitete Marco Donnarumma intensiv an dem vorhin angesprochenen Perspektivwechsel.
Marco Donnarumma: In dieser Zeit habe ich viele andere Stücke gemacht, viele Performances, bei denen es immer darum ging, die Art und Weise, wie ich Klang bis dahin wahrgenommen hatte, hinter mir zu lassen. Das hat viele verschiedene Formen angenommen. Aber auch die Art, wie ich Musik komponiert, produziert und gemixt habe, hat sich in diesen fünf Jahren massiv verändert. Ich habe mich mehr auf die tiefen Frequenzen konzentriert, denn ich bin ohne Hörgeräte und mit Gehörschutz aufgetreten. Das war zu der Zeit, als etwa „Corpus Nil“, „Eingeweide“ und „Alia:zu tai“ entstanden sind. Ich musste als Performer lernen, mich zu Klang zu bewegen, den ich über mein Gehör nur sehr eingeschränkt wahrnehmen konnte. Das bedeutete, dass ich meine Musik anders komponieren musste. Das wurde zu einem Feedback. Ich habe den tiefen Frequenzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, ich habe mir selbst Cues gesetzt, die ich nicht hören musste, sondern mit meinem ganzen Körper fühlen konnte. Am Anfang war es ein mehr praktischer Zugang, aber dann habe ich langsam begonnen, ganz gezielt Musik für vor allem tiefere Frequenzen zu komponieren. 2020 hatte ich gerade den Werkzyklus „Seven Configurations“ abgeschlossen, eine Reihe von Installationen und Performances, in der selbst gebaute robotische Prothesen zum Einsatz gelangen, mit denen ich auch aufgetreten bin. Um mit diesen Prothesen interagieren zu können, musste ich lernen, die Vibrationen ihrer Motoren auf meinem Körper zu interpretieren.
Durch die Anwendung von KI-Algorithmen programmierte Marco Donnarumma seinen selbstgebauten robotischen Prothesen eine gewisse Handlungsfähigkeit ein. Eine dieser Prothesen setzte er sich beispielsweise auf den Kopf, wobei sie seine Augen verdeckte, er also nichts sehen konnte, während ihn die Prothese mit ihrem langen Greifarm oder Rüssel über den Bühnenboden dirigierte. Situationen wie diese zwangen den Künstler Klang, ja, eben mit seinem ganzen Körper zu spüren.
Marco Donnarumma: Viele Puzzlesteine kamen hier also zusammen, bis Sie mich dann kontaktiert und gefragt haben, ob ich ein neues Werk für das musikprotokoll schaffen möchte. Die Idee, den Menschen dort wo sie zu Hause waren, eine interaktive Klangerfahrung bieten zu können, fand ich sehr spannend. Zu der Zeit hatte ich auch bereits eine sehr gute Vorstellung davon, was ich hören konnte und was nicht. Welche Klänge ich körperlich wahrnehmen konnte und welche nicht. Und welchen Einfluss die Technologie, die Hörgeräte auf meine Klangerfahrung haben; wie die Hörgeräte die Art und Weise, wie ich Klang wahrnehme, diktieren. Auch war zu jener Zeit mein politisches Bewusstsein für das Thema der Gehörlosigkeit so weit ausgeprägt, dass ich mich sicher genug fühlte, eine künstlerische Arbeit zu schaffen, die eben die Gehörlosigkeit ins Zentrum stellt. Nachdem „Inanis“ im Wesentlichen ein elektroakustisches Stück war, das im Internet präsentiert wurde, war der Rahmen auch nicht so groß; es ging nicht gleich darum, eine neue Performance zu entwickeln. Es war eine hochqualitative Möglichkeit etwas sehr Experimentelles für mich selbst zu entwickeln, in einem Umfeld, das ich natürlich liebe.
Das Projekt „Tingles and Clicks“, für das Marco Donnarumma „Inanis“ komponierte, hat musikprotokoll Co-Kurator und Producer Fränk Zimmer erfunden. In der Zeit der Corona-Pandemie entwickelte er in Zusammenarbeit mit dem IEM, dem Institut für Elektronische Musik und Akustik der Kunstuniversität Graz, eine Internetumgebung, in der man mit Computer, Webcam und Kopfhörer in interaktive Klangerlebnisse eintauchen konnte, die extra für diese besondere Hörsituation geschaffen wurden. In einem abgesteckten Klangfeld konnte man mit seinen Kopfbewegungen mehrere unterschiedliche Klangquellen ansteuern und so seinen eigenen Mix des jeweiligen Stückes kreieren. Welche Frequenzen kann er hören und spüren, ohne und mit Hörgeräten, diese Frage war der konzeptionelle Ausgangspunkt für die Komposition des Stückes „Inanis“, schildert Marco Donnarumma. Einen Teil der Frequenzen können Hörgeräte verstärken.
Marco Donnarumma: Ja, einen Teil, aber nicht alle. Es entstehen immer Lücken, im höheren Frequenzspektrum, aber sicherlich auch in anderen Frequenzbereichen. Ich wollte mit diesen Lücken, mit dieser Leere arbeiten. Zu jener Zeit hatte ich mich in meiner künstlerischen Arbeit schon lange mit Prothesen beschäftigt. Auch Hörgeräte sind Prothesen. Sie können mir bis zu einem gewissen Grad helfen, aber sie schaffen eben auch diese Wahrnehmungslücken. Ich habe dann ein Stück komponiert, für das ich Field Recordings, elektronische Klänge und Bassgitarren-Klänge verwendet habe. Von diesem Stück habe ich zwei Mixes angefertigt. Der erste Mix richtete sich nach meinem damaligen Hörprofil, dafür habe ich mit jenen Frequenzen gearbeitet, die ich damals ohne meine Hörgeräte hören konnte, das reichte von etwa 40 bis 600 oder 700 Herz. Und für den anderen Mix hab ich mit jenen Frequenzen gearbeitet, die meine Hörgeräte verstärken konnten. Dieser Mix ist gewissermaßen ein Spiegel dessen, was ich einmal hören konnte. Aber wiederum: Es gibt hier diese Lücken. Die Hörgeräte können u.a. nur Frequenzen bis 6000 Herz verstärken.
Zwischen diesen beiden Mixes konnte der Hörer, die Hörerin also hin- und herpendeln, hier zu hören ist der individuelle Mix den mein Kollege Fränk Zimmer mit seinen Kopfbewegungen generiert hat.
MUSIK Inanis
„Inanis“, mit diesem Stück für das musikprotokoll-Projekt „Tingles and Clicks“ hat Marco Donnarumma erstmals die Gehörlosigkeit ins Zentrum seiner künstlerischen Arbeit gestellt. Darauf ließ sich aufbauen und so nahm der Künstler das vielgestaltige Projekt „I Am Your Body“ in Angriff, das wir Ihnen beim musikprotokoll 2025 präsentiert haben. Erste Kontakte in die Gehörlosen-Community gab es bereits, Donnarumma wollte den Dialog nun vertiefen und suchten über einen Open Call nach Gesprächspartnerinnen und -partnern.
Marco Donnarumma: Schließlich war es eine Gruppe von fünf Personen, dazu kam noch ich. Eine Person ist in der Forschung tätig, auch eine Schauspielerin war dabei und ein 15jähriges Mädchen. Mir war es wichtig, dass die Gruppe möglichst divers war, sowohl was den sozialen Hintergrund und das Geschlecht betrifft, aber auch in Bezug auf die Hörfähigkeit. Es gab Personen, die von Geburt an taub waren, die – so wie ich – spätertaubt waren, Schwerhörige, auch eine Person, die sich das Cochlear Implantat wieder herausnehmen hat lassen, machte mit.
Das Projekt war auf zwei Jahre angelegt. Die Teilnehmenden trafen sich in regelmäßigen Abständen. Unter der Diskussionsleitung von Marco Donnarumma entwickelte sich ein kritischer Dialog über die Klangerfahrungen gehörloser und schwerhöriger Personen.
Marco Donnarumma: Das führte unweigerlich auch zu größeren Diskussionen über Macht, über die Macht zwischen einzelnen Personen, aber auch über jene Macht, die Institutionen ausüben. Prothesen werden in der Gehörlosen-Community zwiespältig betrachtet. Und all das kann natürlich aus der Perspektive der Kunst und Musik gesehen werden. Ein wichtiges Thema war auch die Künstliche Intelligenz. Natürlich spielen KI-Algorithmen bei der Entwicklung von Hörgeräten und Cochlear Implantaten mittlerweile eine zentrale Rolle, auch das wollten wir in der Gruppe näher untersuchen. Wir haben mit verschiedenen KI-Algorithmen experimentiert. Dabei ist auch der Prototyp jener neuen Prothese entstanden, die in der Performance „Ex Silens“ nun zum Einsatz gelangt.
Im Detail zu erfahren, wie Gehörlose von Hörenden isoliert werden, sei erschreckend gewesen, so Marco Donnarumma. Das sei schlichtweg skandalös.
Marco Donnarumma: Aber um auch etwas Positives anzumerken: Die Offenheit, mit der diese fünf schwerhörigen und gehörlosen Menschen auf Hörende zugehen, um Brücken zu bauen, habe ich als sehr inspirierend empfunden. So denken zu können, erfordert viel Mut.
Von der Begegnung dieser sechs schwerhörigen und gehörlosen Menschen erzählt der Kunstfilm „Niranthea“, der im Rahmen des Projektes „I Am Your Body“ entstanden ist und während des musikprotokolls in der Neuen Galerie zu sehen war. Er verknüpft Statements mit kunstvollen Aufnahmen der so beeindruckenden Natur Islands und einem Soundtrack, bei deren Schaffung Marco Donnarumma einem ähnlichen Gestaltungsprinzip gefolgt ist, das auch dem vorhin gehörten Stück „Inanis“ zu Grunde liegt. Wiederum fertigte er zwei Mixes derselben Komposition an, die er schließlich übereinanderschichtete. Der erste Mix richtet sich an Menschen ohne Hörbeeinträchtigung, der zweite basiert auf dem Querschnitt der Hörprofile der sechs am Projekt Teilnehmenden. Dafür hackte Marco Donnarumma KI-Algorithmen, die für Hörgeräte und Cochlear Implantate genutzt werden. Man dürfe sich Hörgeräte nicht wie Brillen vorstellen, bei der Verstärkung des Nicht-gehörten entstehen wie bereits vorhin geschildert Wahrnehmungslücken. Bei der Auswahl, welche Frequenzen verstärkt werden sollen, folgen die Hersteller von Hörgeräten und Cochlear Implantaten einem ISO Standard, der sich an der durchschnittlichen Hörfähigkeit von Menschen zwischen 18 und 25 Jahren orientiert, erklärt Donnarumma. Aber schon mit 30 würden Menschen anders hören, denn die Fähigkeit vor allem hohe Frequenzen wahrzunehmen, nimmt mit steigendem Alter ab. So gesehen würden sich eigentlich alle Menschen auf dem Weg in die Schwerhörigkeit befinden.
Marco Donnarumma: Ausgehend von dieser interessanten Beobachtung habe ich die KI-Höralgorithmen umgeschrieben. Sie orientieren sich in der Auswahl der Klangfarben, der Verstärkung und der Lärmminderung nun nicht mehr an dem – unter Anführungszeichen – normalen Hörprofil, sondern passen sich an die Hörfähigkeit der am Projekt Teilnehmenden an. Normalerweise werden alle sehr tiefen Frequenzen einfach eliminiert, ich habe einen Weg gefunden, sie zu bergen und verstärke sie nun. Dafür habe ich die Lautstärke der Frequenzen im oberen und mittleren Höhenbereich signifikant reduziert. Normalerweise werden die wie verrückt aufgepumpt. Und ich habe auch noch weitere Frequenzanpassungen vorgenommen. Dadurch ist die Musik jetzt sehr physisch. Es gibt Teile in der Musik, die nur von Hörenden erlebt werden können, andere Teile wiederum sind den Gehörlosen vorbehalten. Mit der Idee einer vielfältigen Wahrnehmung zu arbeiten, fasziniert mich.
Um die Bässe so intensiv körperlich wahrnehmen zu können, wie intendiert, benötigen Sie nun natürlich einen besonders leistungsstarken Subwoofer. Wir hören die Musik aus dem Film aber ohnehin in einer anderen Fassung, nämlich in jener Fassung, die noch im November bei dem Label Holotone erscheinen wird, auf Marco Donnarummas erster Solo-Veröffentlichung, unter dem Pseudonym „Leiche“. „Annihilating Grace of Infinity“ so der Titel dieses Albums. Das ist das Stück „Vertigo“ daraus.
MUSIK Leiche, Vertigo
Prothesen, also Hörgeräte und Cochlear Implantate werden in der Gehörlosen-Community zwiespältig betrachtet, hat Marco Donnarumma vorhin gesagt, warum ist das so?
Marco Donnarumma: Einige finden Hörgeräte und Cochlear Implantate sehr nützlich, aber andere sehen darin ein Mittel, um die Gehörlosen-Kultur zu unterdrücken. Der Grund ist einfach: Wenn einem gehörlosen Kind ein Cochlear-Implantat eingesetzt wird, dann wird es Schwierigkeiten haben, an der Gehörlosen-Kultur teilzunehmen, denn diese basiert auf der Gebärdensprache. Diesen Menschen wird ihre Identität als Gehörlose weggenommen. Das widerstrebt nun der Intuition, die Hörende haben, aber es ist wichtig, das zu berücksichtigen. Das zu verstehen hat mir dabei geholfen, einen neuen Weg in der Arbeit mit Prothesen zu finden. Auch früher wollte ich, wenn ich Prothesen entwickelt habe, nicht dem Körper dabei helfen, besonders stark zu werden, ich wollte keinen Verlust reparieren. Das hat mich nie interessiert. Mein Interesse galt viel mehr den unterschiedlichen Möglichkeiten, die Körpertechnologien eröffnen. Dieses Thema nun aus der Perspektive der Gehörlosen zu betrachten, hat mein Verständnis von Prothesen noch einmal verändert. Ich habe begonnen darüber nachzudenken, wie ich eine Prothese entwickeln könnte, die es Menschen ermöglicht, ihre Erfahrungen zu teilen. Also nicht diese stereotype Prothese, die individuell auf den Einzelnen zugeschnitten ist, sondern eine Prothese, die etwas Verbindendes hat. Das war ein Wendepunkt, der auch wichtig für die Performance „Ex Silens“ war, die ich als Teil des Projektes „I Am Your Body“ konzipiert habe.
Für diese neue Prothese hat Marco Donnarumma wieder mit Transducern gearbeitet, die er in eine fleischfarbene Kunststoffumhüllung eingebaut hat. Wenn diese Prothese mit Xth Sense verbunden wird, übersetzen sich die Körperklänge in Vibrationen, fühlbar und hier im Folgenden auch hörbar, in Form von leisem Scheppern.
Demonstration neue Prothese
„I Am Your Body“. In „Ex Silens“ verwandelt sich Marco Donnarumma in ein fremdes Wesen von einem fernen Ort. Während durch den Raum die eingangs gehörte Basswelle wogt, steigt dieses Wesen ganz langsam und vorsichtig von seinem Podest, um daraufhin das Publikum zu entdecken. Dabei vollführt es mal ganz feine und dann plötzlich sehr kraftvolle Bewegungen, Xth Sense sendet die Klänge der dabei ausgeführten Muskelbewegungen an den Computer.
MUSIK Ex Silens
Im Laufe der rund 70minütigen Performance durchquert dieses geheimnisvolle Wesen von links nach rechts den gesamten Konzertraum des Dom im Berg und wandelt dabei mitten durch das Publikum, mit dem es auch immer wieder behutsam Kontakt aufzunehmen versucht. Auf halbem Weg warten drei der soeben vorgestellten Prothesen, als „Organe des Teilens“ werden sie auch bezeichnet. Die so außerirdisch anmutende Gestalt biete sie nun den Besucherinnen und Besuchern an, die gleich erleben werden, wie die Körperklänge dieses fremden Wesens in ihre Körper schallen, wie des Künstlers Herz in ihren Händen pocht.
MUSIK Ex Silens
Prothesen, die nicht einen vermeintlichen Verlust reparieren, sondern zu Organen des Teilens werden. Grundlegend sei erst einmal zu verstehen, dass es den normalen Körper nicht gibt.
Marco Donnarumma: Der normale Körper ist eine Fiktion des Kapitalismus, ein Bild, das geprägt wurde, damit sich alle angespornt fühlen produktiv zu sein, straight zu sein, ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen, all das am besten mit weißer Hautfarbe. Aber wie ich immer sage: Wir alle werden irgendwann behindert sein. Das ist die harte Wahrheit. Und es ist nichts per se Schlechtes. So ist unser Körper nun mal gebaut. Er hält nicht ewig, denn er lebt. Es kann nicht anders sein. Aber natürlich ist es bitter, sich dieser Tatsache stellen zu müssen, vor allem für jene, die noch nicht mit ernsteren gesundheitlichen Problemen konfrontiert wurden.
Unsere westliche Gesellschaft baut auf diesem Mythos auf, den wir alle ständig zu nähren versuchen, bis wir nicht mehr können, weil unser alternder Körper einfach nicht mehr mitspielt.
Marco Donnarumma: Um diesen Mythos aufrecht zu erhalten, braucht es natürlich einen Sündenbock, etwas, von dem man sich abgrenzen kann, eine Antithese. Und was ist das? Der behinderte Körper! In unserer Gesellschaft wird der behinderte Körper also dem Mythos der Normalität entgegengesetzt, um die Existenz der Normalität zu untermauern. Dann kann man sagen: Ich bin nicht, wie diese behinderte Person, also bin ich normal. Das macht keinen Sinn, das ist Fake. Das zu hinterfragen, erfordert einen Bruch im Denken, für den man aber nicht erst eine Behinderung bekommen muss, um ihn vollziehen zu können. Letztendlich sind wir alle einfach Menschen, es gibt gute und schlechte Menschen und alles dazwischen. Natürlich führen behinderte Personen ein anderes Leben. Wir Behinderte sind in unserem Alltag mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Ja, ich fühle mich behindert, aber nicht wegen des Zustandes meiner Hörfähigkeit, sondern weil mich die Gesellschaft zu einem Behinderten macht. Sie ist für Menschen wie mich nicht geschaffen.
Was an der Gehörlosen-Community interessant sei, so Marco Donnarumma: Sie begreift sich nicht als eine Gemeinschaft von Behinderten, sondern als eine sprachliche Minderheit, die bis vor kurzem noch darum kämpfen musste, überhaupt anerkannt zu werden. Die Gebärdensprache ist wohl so alt wie die Menschheit selbst, erst vor 20 Jahren wurde sie etwa in Österreich in der Bundesverfassung verankert. Aber dass die Gehörlosen-Community sich eben als sprachliche Minderheit begreift, könnte vielleicht dabei helfen, so Donnarumma, dass Behinderung nicht von vornherein als etwas Schlechtes betrachtet wird.
Marco Donnarumma: Ja es gibt Herausforderungen, ich möchte die Behinderung sicherlich nicht romantisieren. Ich hasse es, wenn ich zum Arzt gehe und mich dieser anschreit, weil er glaubt, dass ich ihn dann besser höre, denn das ist nicht der Fall. Und das ist nun ein triviales Beispiel, Menschen machen noch weitaus schlimmere Erfahrungen. Wenn eine Gesellschaft auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen wirklich eingehen würde, dann wäre die Behinderung einfach nur eine von vielen Formen der Verkörperung.
Wenn er die Körper der Festivalbesucherinnen und -besucher mittels Bass in Vibration versetzt, dann möchte er, dass sie spüren, wie verwundbar sie eigentlich sind.
Marco Donnarumma: Ich möchte dieses Bild von Normalität zerstören, denn es ist eines der größten Probleme. Wenn Sie gelernt haben, auf welch vielfältige Arten Gehörlose Klang wahrnehmen, dann weckt das hoffentlich Ihre Neugierde. Und mit Neugierde lässt sich ein weiteres großes Hindernis überwinden, nämlich die Angst. Wir alle fürchten uns vor dem Unbekannten. Wenn wir das Unbekannte dann kennenlernen, wird die Angst immer weniger und weniger. Wir werden neugierig und können uns mit dem Unbekannten anfreunden.
Am Ende von „Ex Silens“ zieht sich das geheimnisvolle Wesen aus einer anderen Welt, das gerade noch seine Körperklänge mit uns geteilt hat, wieder auf jenes Podest zurück, auf dem es zu Beginn der Performance erwacht ist.
MUSIK Ex Silens
Sie hörten einen Zeit-Ton über das Projekt „I Am Your Body“ von Marco Donnarumma beim diesjährigen ORF musikprotokoll im steirischen herbst. Auf oe1.orf.at haben wir das Manuskript dieser Sendung zum Nachlesen bereitgestellt. Auch am kommenden Dienstag präsentieren wir Ihnen in Zeit-Ton eine Performance, die sich sowohl an schwerhöriges, gehörloses und hörendes Publikum gerichtet hat, die Uraufführung von „Between the Waves“ von Laikka und silentbeat nämlich. Die Übersetzungen hat heute Michael Köppel gesprochen und gestaltet und moderiert hat diesen Zeit-Ton Susanna Niedermayr, ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.