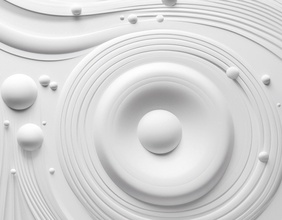Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge - zum Hören
Erika Pluhar & Martin Töchterle.
18. Dezember 2025, 14:18
Intro: Willkommen bei „Gipfelsieg: Der Wille versetzt Berge - zum Hören“, dem Podcast-Format der gleichnamigen ORF Fernsehsendung. In jeder Folge begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe, die auf unterschiedlichste Weise schwere und ehrgeizige Lebensabschnitte zu einem persönlichen Gipfelsieg gemacht haben. Die Sendereihe wurde von 2012 bis 2024 mit insgesamt 40 Folgen auf ORF III ausgestrahlt. Im Podcast „Inklusion gehört gelebt“ erscheint jetzt alle zwei Wochen eine Folge zum Nachhören. Moderiert wird die Reihe von Barbara Stöckl. Initiatorin des Formats ist Marianne Hengl, Obfrau und Gründerin des Vereins Roll on Austria. Sie hat zum Auftakt ein paar persönliche Worte vorbereitet.
Stöckl: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren von der Zugspitze in Tirol. Wir kratzen heute am 3000er. Ich begrüße Sie aus 2962 Meter zum dritten Gipfelsieg.
Initiiert von Marianne Hengl, Obfrau des Vereins RollOn Austria, kommt es heute hier zu einem Gipfeltreffen zwischen dem Maler Martin Töchterle, er ist durch seine Multiple-Sklerose-Erkrankung körperbehindert und sitzt im Rollstuhl, und der Schauspielerin und Schriftstellerin Erika Pluhar. Es geht um ein gemeinsames Nachdenken über Berg- und Talfahrten im Leben, über Anstrengungen, Aufstiege, Rückschläge, ein Gespräch auf Augenhöhe, über ganz persönliche Gipfelsiege.
Liebe Erika, es gibt einige Landschaften, die passen zu dir. Das ist die Wüste, das ist die portugiesische Atlantikküste, das sind die Grinzinger Weinberge. Erika Pluhar und ein Bergmassiv, das kenne ich so gar nicht. Was sagt es dir, was tut es mit dir?
Pluhar: Das kennst du zu Recht nicht besonders gut. Ich bin wirklich kein Mensch der Berge. Ich bin keine Bergsteigerin. Ich kann auch nicht Ski fahren. Und ich weiß nicht so die Landschaft, ich würde sagen, meiner Seele, das ist Hügelland, geht bis ins Flache, ich sehe gern den Horizont. Aber wenn es mich in die Berge verschlägt, dann erschlagen sie mich fast vor Staunen. Also wenn man sieht, was wir heute nicht sehen, was ich aber im Museum der Zugspitze gesehen habe, was die Natur entwirft, eben auch in Gebirgslandschaften, das ist überwältigend. Ich bin gerne auf einem Berggipfel, aber wie du zu Recht sagtest, ich bin wirklich kein Bergsteiger und kein Mensch der Berge.
Stöckl: Martin, du bist im Stubaital aufgewachsen. Was versäumt eine Städterin wie die Erika, wenn sie die Berge nicht kennt?
Pluhar: Eine Hüglerin. Ich bin eine Hüglerin.
Stöckl: Was versäumt eine Hüglerin, wenn sie die hohen Berge nicht kennt?
Töchterle: Was versäumt eine Hüglerin, wenn sie die hohen Berge nicht kennt? Ich glaube, Erika hat genügend Erlebnisse in ihrer Umgebung, die ich versäumt habe, die ich nicht kenne. Also ich würde nie sagen, dass jemand in seiner Heimat irgendetwas anderes versäumt.
Stöckl: Aber wie haben sie dich geprägt?
Töchterle: Das Bergsteigen hat mich natürlich irgendwo geprägt, hat mir viele Erfahrungen ermöglicht, hat mir sicher geholfen, mit Behinderung umzugehen. Heute tue ich mir überhaupt schwer, mit meinen Händen irgendetwas zu greifen. Aber lange Zeit konnte ich mir total gut helfen, habe Griffmöglichkeiten gesehen, die, glaube ich, ein Kletterer lange nicht gesehen hat oder nicht mehr gesehen hat. Sicher auch mental haben die Berge einiges gebracht in Zuversicht oder Selbstvertrauen.
Stöckl: Du hast Multiple Sklerose, eine Krankheit, die auch die Krankheit der 1000 Gesichter genannt wird. Welches Gesicht zeigt sie dir?
Töchterle: Ein unfreundliches. Ich habe diese Krankheit schon sehr lange, über 30 Jahre. Ich habe mich anfangs oft gewundert, warum ich so komisch bin, wo die Unterschiede sind zu anderen. Ich habe gemerkt mit meinen Freunden oder mit meinen Brüdern, mit denen ich Unternehmungen hatte, wie die das so leicht schaffen, wo ich mir schwergetan habe. Was mich an meiner Krankheit, an meiner Multiple Sklerose so manchmal erschreckt, ist die ungewisse Zukunft ganz einfach. Da bin ich durchaus ein bisschen selbstwehleidig. Einfach diese Ungewissheit, die mich immer begleitet. Die ist, glaube ich, etwas, das fast zusätzlich lähmt. Nein, zusätzlich lähmt ist falsch, aber das ist etwas, das mich sehr erschreckt. Nicht zu wissen, wie es in einem Jahr ausschaut, ob ich in einem Jahr überhaupt noch das und das und das kann. Insofern bin ich froh, dass wir heute hier oben sind. Ich weiß nicht, ob es in einem Jahr überhaupt noch möglich wäre.
Gerade wenn ich auf die letzten ein, zwei, drei Jahre zurückschaue, was da noch möglich war und heute nicht mehr möglich ist.
Stöckl: Wie wichtig war es denn überhaupt einmal, dass dann eine Diagnose gestellt wurde? Es hat mit Sehstörungen begonnen, was an sich ein nicht untypisches Anzeichen einer Multiple Sklerose ist, hat aber länger gedauert, bis eine Diagnose gestellt wurde, definitiv. War die dann wichtig für dich?
Töchterle: Ich weiß von vielen, dass die Diagnose fast eine Erleichterung ist. Einfach zu wissen, warum. Gott sei Dank hat es mich anfangs überhaupt nicht bedrückt. Ich weiß noch, dass man mir in der Klinik geraten hat, alles Mögliche, meine Sportarten zu lassen und aufzuhören. Was ich Gott sei Dank nicht getan habe. Inzwischen ist die medizinische Erkenntnis soweit geraten oder hat sich so weit verändert, dass man empfiehlt, so lange wie möglich alles Mögliche zu tun.
Stöckl: Erika, gibt es in deinem unmittelbaren, in deinem nächsten Umfeld eine Begegnung mit dem Thema körperliche Behinderung?
Pluhar: Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, möchte ich sagen. Sie ist jünger als ich. Und ich habe sie kennengelernt, weil sie Konzerte von mir besucht hat. Und wir sind uns dann freundschaftlich nähergekommen. Und sie hat Medizin studiert. Sie hat Kinderlähmung gehabt, als kleines Kind. Und ist ihr Leben lang dadurch behindert. Ich konnte das ein bisschen begleiten und war bei ihrer Promotion. Und sie arbeitet jetzt in einem großen Spital in Wien, sehr hochgeachtet und erfolgreich. Und sie ist meine Ärztin. Und durch ihre Behinderung und durch ihr so schwieriges Leben versteht sie so gut, was einen Körper betreffen kann. Und ich habe ihr auch ein Lied gewidmet, das den Titel „Trotzdem“ trägt.
Stöckl: Das ist dir gewidmet?
Pluhar: Ja, das ist der Trixi gewidmet, weil sie eben von mir immer wieder beobachtet, ein Trotzdem-Leben lebt. Durch sie werde ich auch immer wieder, weil wir uns eben so gut kennen, in einer Weise mit einem Menschen konfrontiert, wo ich sage, das ist ganz selbstverständlich. Ich gehe mit ihr ganz selbstverständlich um. Ich möchte einfach nie in mir auch das Gefühl entwickeln, ich muss sie bedauern. Ich kann ein großes Mitfühlen haben, aber nicht dieses gewisse larmoyante Bedauern, sondern, naja, was ist los? So wie sie als Ärztin auch auf mich reagieren würde. In dieser Form finde ich überhaupt, sollte man mit behinderten Menschen umgehen, über alles reden, ganz normal, weil es ja auch Behinderungen gibt, die nicht körperlicher Natur sind, würde ich sagen, die oft schwieriger sind und mir auffälliger sind. Menschen, die versteinert sind, wo Gefühle nicht mehr vorkommen dürfen, wo nicht mehr geliebt wird, weil man gar nicht mehr weiß, was es eigentlich heißt zu lieben, wo Freude nicht mehr existiert, weil man das Glück sucht oder so.
Stöckl: Kennst du das „Trotzdem-Lied“, Martin?
Töchterle: Nein
.
Pluhar: Es gibt mehrere trotzdem Lieder. Das sind die früheren Lieder. Aber die Trotzdem-Lieder begleiten natürlich jedes meiner... Schau dir das hingespuckte Stück Leben an. Vom Geborenwerden bis hin zum Tod. Wie das nur weh tut und uns quält. Und so müde macht die Suche nach dem Glück. Trotzdem kämpfen wir. Trotzdem glauben wir. Und das Wichtigste. Trotzdem lieben wir... So jetzt ist es genug.
Stöckl: Nein, es ist ganz gut, weil ich ja das trotzdem gerne dem Martin weitergeben möchte, wo das trotzdem in seinem Leben und auch in der Bewältigung seiner Situation liegt. Du hast uns gerade erzählt, du hast die Diagnose bekommen, du hast lange weitergetan, dann ist die Krankheit fortgeschritten und hat dich eingeschränkt, hat dich behindert in einem Maße, das dir auch Sorge macht für die Zukunft. Wie schaut dein Trotzdem aus? Wie ist dein Trotzdem-Leben, dein Trotzdem-Lieben, dein Trotzdem-Weitergehen?
Töchterle: Ich empfinde das Leben oder meine Handlungsweise oder meine Einstellung nicht sehr als trotzdem. Tut mir leid, Erika, ich will dein Lied nicht abschwächen.
Pluhar: Das glaubst du nur, das Lied. Du lebst für mich mit deinem Trotzdem, aber und wie? Das kann man auch anders benennen.
Töchterle: Nein, es ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, Leben ist einfach die Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, etwas zu gestalten. Und das tue ich nicht trotzdem, sondern das tue ich einfach. So gut es geht, selbstverständlich. Ich glaube, da bin ich nicht allein.
Stöckl: Trotzdem erlebst du es mit einer großen Stärke, mit einer künstlerischen Kraft. Deine Ausdrucksform ist die Malerei. Ist deine Kunst auch eine Form der Bewältigung deiner Situation. Zu deinen liebsten Motiven zählen auch jetzt die Berge. Ist das etwa zum Beispiel etwas, wo du sagst, das, was du heute nicht mehr in den Bergen unterwegs sein kannst, das, was du nicht mehr Drachen fliegen kannst, das du nicht mehr Bergsteigen kannst, das malst du jetzt. Also gibt dir das diese Freiheit zurück?
Töchterle: Ich glaube, es ist, jetzt bin ich bei Erikas Büchern, wieder nicht das Trotzdem, man kann nicht leben ohne Vergangenheit. Vielleicht ist es Flucht, vielleicht ist es Wegschauen auch. Ich empfinde es eher so. Ich denke wahnsinnig gerne an die schönen Erlebnisse, die ich hatte. Und ich male die Gegenden, wo ich war. Natürlich gibt man seine Stimmung in die Bilder. Wenn ich zehnmal das gleiche Motiv male, weil es mir so gut gefällt, schauen alle zehn Bilder anders aus. Teilweise sind es einfach Intuitivstimmungen, teilweise sind es ganz absichtliche Versuche, irgendetwas zu ändern, zu erleben.
Pluhar: Er lebt ganz einfach künstlerisch. Das genau ist ein künstlerisches Leben, wenn man verwandelt. Ja, nichts anderes. Jeder künstlerisch motivierte Mensch, und ich rede jetzt nicht von erfolgreich oder Kunst, aber von einem künstlerischen Leben ausgehend, ist es genau das, dass man seine Imaginationen, seine Träume, seine Vorstellungen, dass man Leben verwandelt. Ich muss dir gestehen, hätte ich nicht mein Leben lang Leben verwandeln können, dann hätte mich mein Leben auch nicht gefreut, muss ich zugeben.
Töchterle: Du bist sowieso eine unglaubliche Verwandlerin. Du verwandelst dich von Schauspielerin zu Sängerin zu Autorin, Schriftstellerin und alles Mögliche sind nur einige Teile. Mich würde an dir interessieren, wie du deine Motive umsetzt. Ist da zuerst der Wunsch, dich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen und du schaust dann, womit du es am liebsten oder besten umsetzt? Oder denkst du dir, ich würde gerne wieder einmal ein Buch schreiben, ein Lied singen, was könnte Thema sein?
Pluhar: Es ist eigentlich ähnlich wie dein Vorgang, wie du jetzt beschrieben hast, wie du an dein Malen der Bilder herangehst. Man tut es einfach, weil jetzt ist der Augenblick und jetzt setzt man sich hin. Also ich fange Bücher an zu schreiben und weiß gar nicht, wie sie enden werden. Also ich habe nie so einen vorgefassten Plot, sondern ich habe nur so ein bisschen ein Gefühl in eine Richtung.
Töchterle: Aber ist zuerst das Thema oder ist zuerst der Wunsch nach einem Buch?
Pluhar: Es ist der einfache Wunsch zu schreiben und natürlich in eine thematische Richtung zu gehen. Aber es hat immer etwas damit zu tun, glaube ich, er fragt mich da jetzt Sachen. Nein, es ist eigentlich, du hast auch vorhin das Wort Flucht, es ist nicht Flucht, aber es ist ein Vergrößern wollen, ein Vertiefen wollen des Lebens, in dem man steht. Die Themen sind immer welche, also bei mir, die etwas natürlich auch mit meinem Lebens, ohne dass es jetzt autobiografisch ist, aber Themen, wo ich die Kompetenz des Erlebens hatte oder habe. Einfach Leben zu erfinden, zu verwandeln, zu erweitern. Das ist, glaube ich, mein Wunsch, um auch Leben zu ertragen.
Stöckl: Hat die künstlerische Ausdrucksform nicht immer eine therapeutische Komponente, in dem Sinne, dass sie bei der Bewältigung von schweren Lebenssituationen, von Tiefschlägen, von Einschnitten, dass sie damit zu tun hat?
Pluhar: Natürlich. Schau, ich bin eine ganz, ganz konsequente Tagebuchschreiberin und die gebe ich aber nicht, meine eigenen, die gebe ich auch nicht mehr heraus. Und das ist ein therapeutisches Schreiben. Wenn ich mich am Morgen hinsetze und den vergangenen Tag reflektiere und alle Gedanken, dann ist das ein Dialog mit mir oder mit wem auch immer. Ich will dann, wenn man die Dinge, wie es so schön heißt, herausgibt, dann darf das nicht mehr Therapie sein, dann muss das mit Professionalität zu tun haben. Das ist der Unterschied. Aber ich kann jedem Menschen nur versuchen zu überzeugen, wie gut es ist, Dinge niederzuschreiben. Und zwar wirklich auch zu schreiben. Wir leben ja jetzt in einer Zeit... Aber das Niederschreiben, das heißt ja auch schon so schön, ist wirklich eine gute Möglichkeit, sich auch zeitweise zu erlösen.
Stöckl: Wie hat dir diese Ausdrucksform oder auch das Singen oder auch das Schauspielen bei ganz konkreten, schweren Lebenskrisen geholfen?
Pluhar: Ich kann ganz direkt darauf zugehen, weil ich das ja nie verschweige. Ich habe vor jetzt 15 Jahren meine 37-jährige Tochter verloren, die genau geboren ist in dem Alter wie du. Und mir hat sicher…geholfen ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war eine Überlebensmöglichkeit, dass ich davor ein Buch begonnen habe. Dass ich nach ihrem Tod weitergeschrieben habe, weil da so Schienen ausgelegt waren. Ich konnte also über ihren Tod schreiben, ohne ihren persönlichen Tod zu beschreiben. Und ich erfuhr von ihrem Tod, als ich gerade eine Schallplatte aufgenommen habe, und die haben wir ein paar Wochen später weitergeführt. Und alle Freunde kamen ins Studio und haben mit mir gemeinsam einen Chor gesungen. Also wenn man diese Möglichkeit, auch wieder es umzuwandeln. Es zu verwandeln hat mir sicher das Weiterleben erleichtert.
Stöckl: Martin, wie ist das bei dir? Hat dir die Malerei oder hilft sie dir immer noch, mit deiner Situation auch im Rollstuhl besser zurecht zu kommen?
Töchterle: Ohne Rollstuhl täte ich mir mit Malen leichter. Gerade in den letzten Monaten ist das Malen sehr schwierig geworden. Weil einfach die Kraft hinten auch nachlässt. Und die Geschicklichkeit. Ich habe Probleme, dass mir der Pinsel aus der Hand fällt während des Malens und auf der Hose landet oder auf dem Teppich. Das Reinigen des Pinsels auswaschen ist sehr schwierig geworden. Ich glaube, was du gesagt hast, Erika, es ist einfach die Intention, ob es therapeutisch ist, primär oder nicht. Ganz einfach die Absicht, ob man es als Therapie betreibt. Ich glaube, die Selbsttherapie in dem Sinn ist schwierig. Es würde nur funktionieren, wenn jemand das Bild dann genau analysiert. Es gibt tolle Bücher, die ich gelesen habe über Malerei in der Therapie und so weiter. Es hilft, aber es ist vielleicht prima nicht Therapie.
Stöckl: Erika, war die Malerei je eine Idee, dass sie auch deine Ausdrucksform wird? Sie ist dir ja nicht so fern. Deine Mutter hat gedichtet und gemalt, dein Großvater war Glasmaler und deine Schwester ist Malerin und Bildhauerin. Udo Jürgens singt ja bekanntlich über seinen Bruder: Mein Bruder ist ein Maler, mit sehr großer Wertschätzung und Bewunderung für vieles. Wofür bewunderst du deine Schwester, die malt?
Pluhar: Sie ist eine wirkliche Künstlerin, auch für meinen Begriff. Und an ihr bewundere ich vor allem ihre Konsequenz, sich keinem Trend und keinem Zug der Zeit und keinem zeitgeistigen Wunsch. Es gibt ja immer so, gerade so im Kulturbetrieb, ist auch so ein grausliches Wort, aber so schaut es da auch aus. Da gibt es natürlich immer Trends und dann gibt es geschickte Leute, die diesen Trend nutzen. Und meine Schwester, meine jüngere Schwester, Ingeborg Pluhar, die hat einfach immer mit einer bewundernswerten Sturheit ihren Weg verfolgt in der Malerei, in der bildenden Kunst und hat sich da still, aber konsequent auch einen Namen erworben und eine Beachtung und eine Hochachtung erworben. Mir gefallen Menschen, die bei dem bleiben, was ihres ist. Und ich habe beobachtet, dass Menschen, wenn sie Qualität haben, in welcher Form auch immer, wenn sie Würde haben, auch immer wieder bemerkbar sind. Die gehen auch nicht verloren. Sicher nicht in diesem aufwendigen Society-Betrieb, wo man auf eine sehr billige Weise Aufmerksamkeit erringen möchte. Eine Aufmerksamkeit von klugen Menschen auf kluge Menschen, das ist was Schönes.
Stöckl: Also es gibt das Lied von Erika Pluhar, meine Schwester ist eine Malerin, noch nicht, aber in deinen Worten klingt es ein bisschen nach großer Wertschätzung und fast ein bisschen Bewunderung.
Pluhar: Auf jeden Fall.
Stöckl: Ihre Brüder können singen, mein Bruder ist ein Maler. Sie umgekehrt müssten wieder singen, mein Bruder ist ein Minister. Denn Ihr Bruder, Ihr großer Bruder ist Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töchterle, von dem Sie ja auch schon ein Porträt gemalt haben. War das eine besonders schwierige Aufgabe, ihn als Rektor der Uni Innsbruck damals zu malen?
Töchterle: Wenn, dann würde ich über alle drei Brüder singen, was sie so veranstaltet haben. Nein, ich glaube, die können alle für sich selber gut reden. Das Porträt, das ich von Karl-Heinz gemalt habe, freut mich natürlich sehr und macht mich auch stolz durchaus. Vielleicht ist noch wesentlicher, dass ich es dabei einfach genossen habe, ein Porträt zu malen. Porträts sind fast das liebste Motiv. Das Dumme bei den Porträts, es gibt zwei dumme Sachen bei den Porträts, die denen innenwohnen. Das erste ist, dass sich kaum jemand Zeit nimmt so lange Modell zu sitzen. Und das ist der Genuss, sein Gesicht zu studieren. Das ist der Genuss und ein bisschen zu reden und es gemütlich zu haben. Dieses Porträt zu malen hat mich unheimlich befriedigt.
Stöckl: Aber es war eine Gelegenheit, wie Sie gesagt haben, diese Landschaft des Gesichtes zu studieren und noch besser kennenzulernen. Die Sendung, die wir hier auf der Zugspitze heute aufzeichnen, hat den Titel Gipfelsieg, Ersonnen von Marianne Hengl. Und dieses Wort ist ja nicht gemeint als das erstrebenswerte Ziel, sondern durchaus als Synonym, als Symbol dafür, was alles drinsteckt, an Aufstiegen, an Mühsal, an Anstrengungen, auch an Rückschlägen. Was verbindest du mit dem Wort Gipfelsieg?
Töchterle: Ich habe festgestellt, dass der Ausdruck Gipfelsieg für mich nicht relevant ist. Aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass mir das Wort Sieg ein bisschen zu sehr ideologisch besetzt ist. Das andere ist noch primärer, noch stärker. Ich hatte eigentlich auf keinem Gipfel weder auf einem im physischen Gipfel noch im übertragenen Sinne hatte ich das Gefühl eines Sieges. Und es geht nicht um den Gipfel, es geht um das Erlebnis, das man dabei hat. Wenn es nur um den Gipfel ginge, wäre das so, wie wenn man das ganze Jahr nur auf Weihnachten warten würde und die restlichen 364 Tage nicht genießen könnte. Nein, es ist das Erlebnis, das dabei ist, bei allen Dingen, bei jedem Gipfelerlebnis.
Stöckl: Was kannst du mit dem Wort Gipfelsieg anfangen, Erika? Kannst du zwischen dem Aufstieg auf einem Gipfel zu einem Ziel, zu etwas, was man erreichen will, und dem Lebensweg Parallelen sehen?
Pluhar: Mir ist natürlich schon bei diesem Begriff, dieser Rilke-Satz eingefallen, wer spricht von Siegen, überstehen ist alles. Und wenn ich es ein wenig umdenke, ja, dann und eben auch dieses sehr besetzte Wort „Sieg“ dann doch nutze, dann ist für mich vielleicht jeder gut und achtbar von mir selbst, achtbar, würdevoll, in einer gewissen Weise nahezu gelungen überlebte Tag auch ein kleiner Gipfelsieg. Ich bin auch schon so alt, dass ich am Morgen immer sehr darüber nachdenken muss, wie alt ich bin, jetzt ohne Lamoyanz möchte ich sagen. Aber man weiß dann einfach, dass diese Tage immer gezählter werden. Und wenn man als alter Mensch einen freudvollen Tag und einen tätigen Tag, einen sogar energievollen Tag, erleben darf. Also da sage ich mir, das ist dann immer wieder ein kleiner Gipfelsieg.
Stöckl: Wobei den Sieg, Martin, bei dir muss ich doch schon nochmal hinterfragen, weil das ja ein Mann sagt, der früher nicht nur sportlich sehr aktiv war, sondern auch als Wettkampfsportler sehr aktiv war. Das heißt, damals war Siegen sehr wohl ein Kriterium in deinem Leben und du hast auch oft gewonnen. Du warst unter anderem mit deinem Team, mit deinen Freunden Staatsmeister, sogar im Rafting bist Drachen geflogen, bist Berg gestiegen. Das heißt, da war Gewinnen, da war erstes ein Kriterium. Hat sich das dann erst mit der Zeit verändert, dass du zu der Aussage vorher kommst, dass du ein Problem mit dem Wort Sieg hast?
Töchterle: Da muss ich zwei Dinge herausgreifen. Das erste ist der Staatsmeister in Rafting. Das muss ich ganz kurz doch erzählen. Das hat angefangen bei einer Hochzeitsfeier am Ahornboden in Hinteriß. Da habe ich mit meinen Tischkollegen ein Gespräch geführt und wir sind draufgekommen, dass wir beide gerne Wildwasser paddeln. Er hat mir dann erzählt, er hat jetzt etwas Neues, nämlich Rafting versucht. Das war damals wirklich neu, relativ neu bei uns. Habe ich Interesse, mal mitzufahren mit seinen Kollegen und ihm. Auf der Hinfahrt habe ich erfahren, dass gleich ein Rennen wäre. Erster Tag freies Training, zweiter Tag Qualifikation für Startplatz. Also eine Kurzregatta, dritter Tag eine lange Regatta, am vierten Tag ein Slalom und am Ende haben wir die Gesamtwertung gewonnen. Ich war sicher das kleinste Rädchen in diesem Team.
Stöckl: Der Rafting-Staatsmeistertitel war also kein so gutes Beispiel, um das Thema Sieg zu thematisieren. Aber trotzdem, hat sich für dich dieser Zug nach vorne, das Gewinnen wollen, Erster sein wollen, auch überhaupt das Thema Leistung und Leistungsdruck durch deine Behinderung auch verändert?
Töchterle: Das war ja noch nicht der Staatsmeister, das war ein Rennen. Wir haben dieses Rennen auf der Isl im darauffolgenden Jahr und im übernächsten Jahr wieder gewonnen und sind auch zwischendurch Raften gegangen miteinander. Und irgendein Rennen hieß dann eben Staatsmeisterschaft und das war ganz in der Nähe in Landeck. Und es waren Boote aus ganz Österreich und ich weiß nicht wie viele. Nein, der Sieg stand tatsächlich nicht im Vordergrund. Heute erinnere ich mich total gerne an Erfolge, eh klar. Aber hängengeblieben ist mir das Persönliche mit den Teammitgliedern.
Stöckl: Aber wenn man sich jetzt deinen Lebenslauf anschaut und sieht, dass einfach körperliche Betätigung und Sport eine wichtige Rolle in deinem Leben war, und das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Sportarten, Bergsteigen, Raften, Drachenfliegen, das sind Sportarten, die auch für ein gewisses Freiheitsgefühl stehen. Und jetzt ist dir diese Freiheit durch die Behinderung, durch die Krankheit genommen. Wo findest du eine neue Freiheit? Wie hast du diesen Begriff umgestaltet?
Töchterle: Das ist vielleicht genau diese Einstellung, dass es nicht um den Gipfel geht, sondern um das Erlebnis. Und das ist vielleicht die Parallele von Erika und mir. Als ich ihre, deine Bücher gelesen habe, habe ich mir so oft gedacht, ja, es sind genau diese Erlebnisse, die inneren Erlebnisse, die bauen einen total auf. Ich denke mir heute oft, wenn ich all diese Sportarten noch tun könnte, hätte ich manchmal einen fürchterlichen Stress. Nein, ich genieße es heute. Mit den Kindern, wahrscheinlich genieße ich es mehr als sie, mit den Kindern etwas zu tun und einfach für die Familie da zu sein. Natürlich genieße ich auch wieder meine eigene Zeiten zu haben. Ich glaube, die Energie holt man sich bei den Sachen, die man gerne tut.
Pluhar: Das ist so ein richtiges Wort, finde ich, das Tun. Ich versuche eigentlich auch immer, diesen Begriff zu verwenden, das Tun. Ich habe mich nie sportlich betätigt. Ich bin ein bisschen wie Churchill. In meinem Leben ist eher no sports. Aber ich habe auch einen Beruf gehabt, jahrelang, wo man siegen musste, bei der Premiere. Und ich weiß genau, dass ich deswegen Premieren gehasst habe, weil eine normale Vorstellung vor einem Publikum, in die man sich wunderbar hineinkonzentriert, die man durchlebt. Aber bei der Premiere war dieser Druck. Das muss heute so gut sein wie nie und ich war sofort so schlecht wie nie. Eigentlich fast bei jeder Premiere. Also das Tun, ohne diesen Anspruch jetzt unbedingt zu siegen, sondern zu tun, um sich daran zu erfreuen oder dass es das Leben bestimmt, da sind wir sehr d'accord, glaube ich.
Stöckl: Martin, wie schwierig ist für dich das Sich-Fortbewegen geworden? Du bist heute auf den Rollstuhl angewiesen und da gibt es ja dann Hürden, über die man sich vorher wahrscheinlich niemals Gedanken gemacht hat.
Töchterle: Es gibt ganz einfache Hürden, da könnte ich explodieren, weil es einfach Gedankenlosigkeit ist oft, die eine Hürde gebaut hat. Die Vollbewegung an und für sich mit dem Rollstuhl ist ja toll. Hat einen großen Vorteil, ich habe immer einen Sitz, wenn ich stehenbleibe irgendwo. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese äußeren Hürden, die man kaum beachtet, wenn es einen nicht wirklich selbst betrifft, das kann ich mir schon vorstellen, wie schwer es ist, damit zu leben. Und ich weiß es eben auch durch meine Freundin, wenn ich mit ihr unterwegs bin und wenn man anfängt, das ein wenig mitzubeachten. Ich bewundere das sehr, wenn man mit all diesen Hürden. Trotzdem.
Töchterle: Danke für die Bewunderung. Es gibt nichts zu bewundern in dem Fall. Wirklich oft ein durchkämpfendes Kämpfe. Meist ohne wirklichen Sieg, ohne Sieggefühl vor allem. Es gibt Gehsteige, die irgendwo enden plötzlich. Du kannst hunderte Meter zurückfahren bis zum letzten Zebrastreifen. Im Krankenhaus ist es schwierig, dass ich die Tür wieder zukriege, wo ich hinein bin, weil ganz einfach der Griff fehlt, was eigentlich im Krankenhaus wirklich Standard sein sollte.
Stöckl: Wie viel Hilfe und Unterstützung brauchst du zur Bewältigung deines ganz alltäglichen Lebens? Du bist verheiratet, du hast eine Frau, du hast zwei Kinder, du hast Assistenten, die dir helfen. Erzähl uns ein bisschen von der Strukturierung und von der Organisation deines Alltags.
Töchterle: Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich mich fast nicht mehr traue, allein zu sein. Erst kürzlich vor zehn Tagen oder so war ich kurz allein daheim, eine halbe Stunde ohne. Halte ich normalerweise gut aus, aber genau da natürlich muss ich aufs WC und bin unglücklich gestürzt. Ein Fall, der normalerweise immer geht. Nein, das Leben lässt sich natürlich nie organisieren ganz ohne Unfälle. Aber das betrifft jeden, dass er irgendwo hinwill und stolpert oder irgendwas. Die Hilflosigkeit ist schon fürchterlich. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, ich bin im Rollstuhl, aber ich bin glücklich. Irgendwo bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich so im Rollstuhl bin und ich bin dankbar für all die Sachen, für meinen Wohnort. Ich bin absolut glücklich und dankbar für meine Familie, die eine Aufgabe geben, die Kinder, die Frau, die ich sehr liebe und die, wo ich Liebe spüre und die mir sehr hilft, wo überall sie kann.
Stöckl: Deine Kinder sind elf und zwölf Jahre, das heißt, sie kennen dich gar nicht anders als körperbehindert. Was bedeutet das für sie? Was vermissen Sie, wovon profitieren Sie vielleicht auch?
Töchterle: Profitieren dürften sie vielleicht, weil sie sehr selbstständig sind. Ich hoffe, dass sie ein bisschen Toleranz und Verständnis für diese Art mitkriegen. Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Ich glaube, ich weiß, dass es so ist. Mit Kindern läuft alles nicht so ganz wie man es plant und will, Gott sei Dank, Kinder sind eigene Menschen.
Pluhar: Schön, dass sie sind. Du hast zwei gesunde Kinder und du hast eine Frau, die dich liebt und die du liebst. Das sind Geschenke
.
Töchterle: Das hätte ich gesagt, wenn du mich gefragt hättest, was ich mir wünsche. Hätte ich gesagt, mein Wunsch ist bereits in Erfüllung gekommen.
Stöckl: Du hast vorher von der Hilfe, von der Unterstützung, die du bekommst und die du auch brauchst für dein Leben erzählt. Hilfe muss man auch annehmen können. Und das ist oft gar nicht so ein einfacher Prozess, der ja auch sehr intime Bereiche betrifft. Du hast gerade vorher erzählt von einem Sturz, von einem Unfall am Weg zur Toilette. Wie viel Scham ist da dabei und wie schwierig war es, diese Schamgrenze auch zu überwinden?
Töchterle: Das war für mich überhaupt kein Thema. Ich musste schon einmal kurz darüber nachdenken. Ich bin total froh, wenn ich Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Da stellt man sich die Frage nicht. Ich stelle sie mir nicht. Kann ich das annehmen? Wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht. Wenn ich es brauche, bin ich dankbar, wenn ich es habe.
Stöckl: Erika, inwiefern kannst du aus diesem Tun, aus dem Leben auch, von einer gewissen offensichtlichen Verletzlichkeit und Schwäche auch Stärke erkennen?
Pluhar: Seit ich ihn kenne sehe ich da diese Stärke. Die aber nicht in einem Starksein so im üblichen Gebrauch dieses Wortes, sichtbar ist, sondern ich glaube, Stärke hat damit zu tun, sich dem Leben zu stellen. Weniger jetzt, ob man siegt, ob man verliert, aber sich dem Leben zu stellen. Da komme ich dann doch ein bisschen auf das Wort, das dir nicht so gefällt, es auch anzunehmen. Aber weder als ein Geschenk noch als eine Wohltat, sondern das Leben einfach, ich will jetzt nicht kitschig sein, aber das Leben auch zu lieben. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich das sage. Das wollte ich sagen. Denn nichts ist schwieriger. Da spricht die Spezialistin. Nichts ist schwieriger als gegen so vieles, das dagegenspricht, das Leben zu lieben.
Stöckl: Wie hat sich denn überhaupt, du warst ja früher auch beruflich tätig als Berufsschullehrer, hast diesen Beruf dann aufgegeben. Wie hat sich der Blick von außen, die Wahrnehmung deiner Person durch andere verändert? Schwingt da auch viel Mitleid mit, weil ich eben spüre, dieses mitleidigen Blick, Demut hast du genannt, ist was, was du nicht magst. Wie ist das heute?
Töchterle: Ich glaube, die Menschen und die Freunde, die ich heute noch treffe, da merk ich sehr wenig Veränderung.
Stöckl: Aber empfindest du so etwas wie Mitleid, das dir entgegenschlägt und hast du damit ein Problem?
Töchterle: Ich empfinde diese Einstellung des Mitleids sehr selten, eigentlich nie. Eher bei völlig Unbekannten, die ich irgendwo treffe, weil ich irgendwo ausnahmsweise mal nicht zu Hause bin. Da kommt eher diese Einstellung daher, dass die Eltern zu den Kindern sagen, schau nicht hin, schau nicht hin. Natürlich schauen Kinder hin und es ist völlig normal, wenn man auffällt mit einem Rollstuhl, fällt man auf. Es ist völlig normal, dass jemand hinschaut. Und manchmal zeige ich den Kindern dann irgendwas am Rollstuhl oder so. Es ist völlig normal, dass Kinder einen anschauen. Ich finde es viel weniger normal, dass Erwachsene so konsequent wegschauen.
Pluhar: Das ist schon ein schrecklicher Hinweis, schau nicht hin. Das ist einer dieser Hinweise, die dann prägen.
Stöckl: Martin, welchen Umgang mit dem Thema Behinderung wünschst du dir denn in der öffentlichen Wahrnehmung?
Töchterle: Das ist ein großes Thema für mich. Die Öffentlichkeit oder fremde Menschen tun sich natürlich oft schwer. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Soll ich dem helfen? Soll ich dem nicht helfen? Soll ich ihn ansprechen? Soll ich ihn ignorieren? Ich denke, der richtige Umgang mit Behinderten wäre in diese Richtung. Die Medien haben da eine gewisse Aufgabe. Vielleicht kann ich heute ein bisschen dazu beitragen. In den Medien sieht man entweder Behinderte gar nicht. In den letzten Jahren wurde es immer mehr. Das Thema Behinderung ist heute ein viel Größeres in den Medien. Eine kleine Schwierigkeit dabei ist einfach, dass man üblicherweise irgendetwas Besonderes sieht. Man schaut sich ja auch den normalen Tänzer oder den besoffenen Sänger nicht an im Fernsehen, oder? Also irgendetwas Besonderes soll der vielleicht haben. Man sieht oft die Supersportler und alle denken sich, ah, der ist eh so gut organisiert, da geht eh alles. Finde ich total wichtig, dass man das sieht. Ich finde es total wichtig, dass man Menschen wie die Marianne sieht, die ein Organisationstalent hat wie nur wenige. Die Wahrnehmung gehört nur erweitert, meines Erachtens, dass man wirklich auch sieht, Schwächen. Es geht eben nicht alles. Nicht jeder ist Supersportler, nicht jeder kann sich das erschließen. Nicht jeder kann über einen Schotterweg fahren mit seinem Rollstuhl. Die heute überall so gefragten, modernen, zur Ortsbildgestaltung beitragenden Kopfsteinpflaster sind für einen Rollstuhlfahrer ein Riesenproblem. Es gibt viele Probleme, wie ich schon gesagt habe, die Türen, die sich nicht schließen lassen. Es gibt verschiedene Behinderungen und nicht jeder Rollstuhlfahrer ist automatisch ein Supersportler und nicht jeder schafft es, sich sein Leben zu organisieren und angenehm zu gestalten.
Stöckl: Wie stark muss man sein, Erika, um Schwäche zu zeigen, um zu Schwäche auch zu stehen, um auf Schwäche zu schauen, um seine Verletzlichkeit preiszugeben? Das ist ja etwas, was du als öffentlicher Mensch, als öffentliche Frau, wie dein Buch, das im Herbst rauskommt, auch heißen wird, immer wieder getan hast. Du hast deine Schwäche, deine Verletzlichkeit nie versteckt.
Pluhar: Ich glaube, es geht nur, wenn es sich verbindet mit einer großen Aufrichtigkeit. Wenn man versucht, diese Schwäche zu bemänteln oder zu übertreiben oder zu untertreiben. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein abgebrauchtes Wort, aber nötig ist die Wahrhaftigkeit. Und mit Wahrhaftigkeit machst du dich den Menschen auch irgendwie verständlich. Und ich weiß noch genau, ich war nach dem Tod meiner Tochter ganz schnell in einer Talkshow, das war damals noch dieser Herr Biolek, der war sehr zartfühlend und so. Und dann habe ich in dieser Sendung gleich darüber gesprochen, dass ich weiß, dass ich nicht die einzige Mutter bin, die ein Kind verloren hat. Und ich habe gemerkt hinterher, wie dadurch alles an dummen, an sensationslüsternem Interesse war weg. Und ich halte ganz, ganz viel davon, dass man nicht versucht, durch irgendeine Tenue stark zu sein, sondern dass man überhaupt nur stark sein kann, wenn man ehrlich ist. Ich bin ein großer Verfechter der Aufrichtigkeit und der Wahrhaftigkeit. Das klingt ein bisschen so, sind so Begriffe, die so durch die Luft schwirren. Aber wenn man es ernst nimmt, gerade in einem Beruf wie Schauspielerei oder auf Bühne gehen und Menschen um sich zu haben und gerade in einer Situation, wo Menschen schauen und sagen, schau nicht oder schau oder so. Ich glaube, dass da wirklich nur zwischen den Menschen es geht mit der absoluten, selbstverständlichen Wahrhaftigkeit.
Stöckl: Liebe Erika Pluhar, lieber Martin Töchterle, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch auf Augenhöhe, für Anregungen für unsere Zuschauer, für diesen dritten Gipfelsieg heute von der Zugspitze. Dankeschön euch, Dankeschön Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen
.
Outro: „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“ ist eine Produktion von ORF III. Hergestellt von Kiwi-TV in Zusammenarbeit mit RollOn Austria.