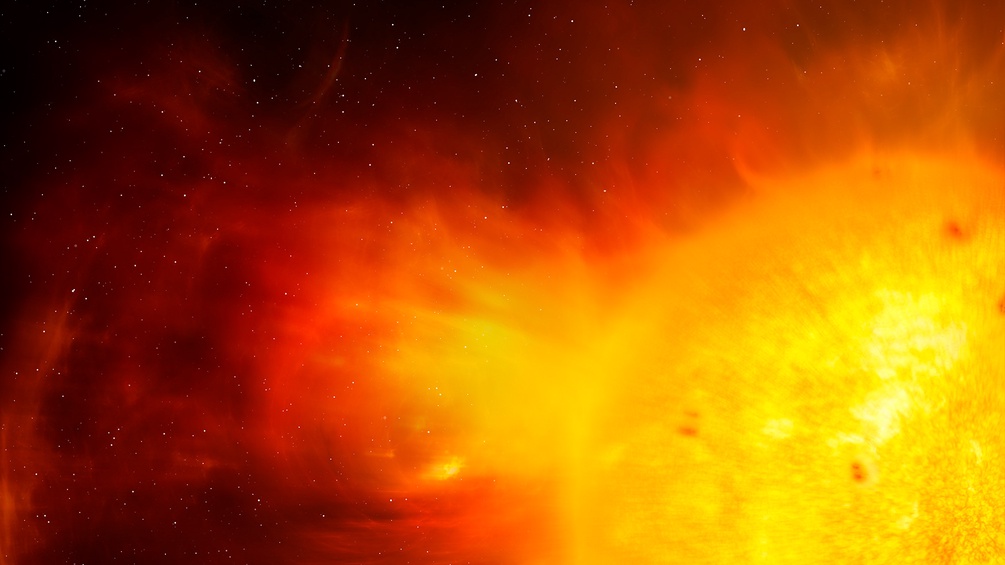
AP/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Punkt eins
Unruhe auf der Sonne
Flecken, Flares und Sonnenwinde: Über die zunehmende Sonnenaktivität und ihre Auswirkungen. Gast: assoc.Prof. Dr. Manuela Stadlober-Temmer, Forschungsgruppe Heliosphären-Physik (HPRG), Institut für Physik, Universität Graz. Moderation: Barbara Zeithammer. Anrufe 0800 22 69 79 | punkteins(at)orf.at
24. Jänner 2024, 13:00
Schon im Vorjahr leuchtete der Nachthimmel sogar in Mitteleuropa mancherorts in Neonfarben; 2024 soll das Jahr der Polarlichter werden. Das heißt auch: das Weltraumwetter wird rauer, es werden mehr Sonnenstürme zu erwarten sein, denn die Sonne steuert heuer auf ihr Aktivitätsmaximum zu. Was das zu bedeuten hat, erläutert die Grazer Sonnenphysikerin Dr. Manuela Stadlober-Temmer, Spezialistin für Weltraumwetter-Forschung in dieser Ausgabe von Punkt eins.
Dass unser Stern nicht immer gleich aktiv ist, mag überraschen, ebenso, dass die Veränderungen - die Zahl der Sonnenflecken, die Stärke des Sonnenwindes und andere Phänomene - einer gewissen Regelmäßigkeit folgen. Seit der Antike werden dunklere (weil kühlere) Stellen auf der Oberfläche der Sonne beobachtet. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts werden diese Sonnenflecken systematisch erfasst. Alle etwa elf Jahre erreicht ihre Zahl und damit auch die Sonnenaktivität ein Maximum, das mit Veränderungen des Magnetfelds im Abstand von 22 Jahren einhergeht. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 befindet sich unser Stern im so genannten 25. Sonnenfleckenzyklus (nummeriert seit 1749); das Zyklusmaximum sehen Fachleute in einer aktualisierten Prognose im heurigen Jahr erreicht.
Die Sonnenaktivität bestimmt das Weltraumwetter und hat vielfältige Auswirkungen auf die Erde. Ein starker Sonnensturm kann den Funk stören oder zu Problemen in der technischen Infrastruktur führen. Gefährdet sind vor allem Satelliten: am 4. Februar 2022 verglühten in Folge eines Sonnensturms fast 40 gerade erst gestartete Satelliten der US-Firma Space X.
Mehrere Raumsonden und -Satelliten beobachten und vermessen unseren Stern genau; die 2018 gestartete NASA-Sonde Parker Solar Probe soll noch mehrmals die Korona (die äußere Sonnenatmosphäre) durchfliegen; die ESA Sonde Solar Orbiter ist seit Februar 2020 unterwegs, um den Sonnenwind zu untersuchen.
Die Astrophysikerin Dr. Manuela Stadlober-Temmer leitet die Forschungsgruppe Heliosphären-Physik an der Universität Graz und untersucht Phänomene wie koronale Masseneruptionen und starke Strahlungsausbrüche (Flares), deren Weg durch den interplanetaren Raum und die Auswirkungen auf die Erde. Ein weiteres Spezialgebiet der Sonnen- und Heliosphärenphysikerin ist die Weltraumwettervorhersage: Sie hat mehrere Methoden der Weltraumwettervorhersage für die Erde und den Mars entwickelt. Manuela Stadlober-Temmer leitet auch ein internationales Weltraumwetter-Aktionsteam und lehrt am Institut für Physik der Universität Graz.
Von Weltraumwetterforschung bis "was ist was", vom aktuellen Stand der Wissenschaft über die Rätsel der Sonne und die Bedeutung ihrer zunehmenden Aktivität: als Gast bei Barbara Zeithammer und im Gespräch mit den Hörerinnen und Hörern von Punkt eins erläutert Manuela Stadlober-Temmer die Erforschung unseres Sterns und seine Eigenheiten.
Was wollten Sie immer schon über unsere Sonne wissen? Welche Phänomene haben Sie als Hobby-Astronom oder -Astronomin beobachtet, was fasziniert Sie?
Sie erreichen uns während der Sendung kostenfrei aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79 und schriftlich per E-Mail an punkteins(at)orf.at
Sendereihe
Gestaltung
- Barbara Zeithammer
Playlist
Untertitel: Joseph Haydn
Titel: String Quartet in E-Flat, HIII No. 31, Op. 20, No. 1_ IV. Presto
Ausführende: Hagen Quartett
Länge: 02:21 min
Label: Deutsche Grammophon
Untertitel: Joseph Haydn
Titel: String Quartet in G Minor, HIII No. 33, Op. 20, No. 3_ II.
Ausführende: Hagen Quartett
Länge: 04:00 min
Label: Deutsche Grammophon




