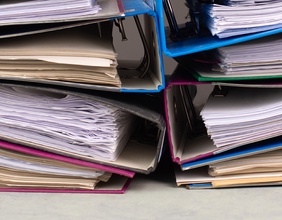PICTUREDESK.COM/AP/DARKO VOJINOVIC
Punkt eins
Einladen, ausladen, boykottieren
Druckmittel soziale Ächtung und Cancel Culture. Gäste: Dr. Emil Brix, Historiker, ehem. Direktor der Diplomatischen Akademie Wien, Direktor der Österreichischen Forschungsgemeinschaft & Dr. Daniela Strigl, Germanistin, Literaturkritikerin, Autorin. Moderation: Alexander Musik. Anrufe 0800 22 69 79 | punkteins(at)orf.at
13. Oktober 2025, 13:00
2007 wurde Peter Handkes Stück "Spiel vom Fragen oder Die Reise ins sonore Land" aus politischen Gründen vom Spielplan der Comédie Francaise genommen. Begründung des renommierten Pariser Theaters: Handke habe am Begräbnis des ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic teilgenommen und am Grab "skandalöse" Dinge gesagt. Damals gab es den Begriff Cancel Culture noch nicht; man sprach von Zensur.
Die Liste mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, denen eine Bühne gegeben und dann wieder entzogen wurde, die "gecancelt" wurden, ist lang. Genau so lang wie diejenige, die gleich von vorneherein nicht mehr eingeladen werden: Weil sie einmal etwas Falsches gesagt haben oder die Gefahr besteht, dass sie es tun könnten - etwas Falsches in den Augen derer, die für sich Deutungshoheit und korrektes moralisches Augenmaß in Anspruch nehmen.
Der Weg von der Cancel Culture zum Boykott ist nicht weit. Beispiel: der Eurovision Song Contest (ESC). Die sich betont unpolitisch gebende europäische Schlager-Parade ist zum Politikum geworden: Irland, Slowenien, die Niederlande, Island, Belgien und Spanien haben angekündigt, den Song Contest zu boykottieren oder ihre Teilnahme zu überdenken - falls Israel mit dabei ist. Deutschland wiederum drohte auf höchster Ebene damit fernzubleiben, falls Israel ausgeschlossen werde: ein "Boykott der Boykottierer", wie die Süddeutsche Zeitung das nannte. Anfang November sollen nun die teilnehmenden Länder im Auftrag des Veranstalters des Bewerbs, der Europäischen Rundfunkunion (EBU), darüber abstimmen, ob Israel im Mai 2026 in Wien dabei sein soll oder nicht.
Die Geschichte der Boykotte ist lang - insbesondere im Sport. Immer wieder boykottierten Länder die Olympischen Spiele und ließen ihre Sportlerinnen und Sportler nicht antreten - eine Machtdemonstration, die es auch in der Variante "diplomatischer Boykott" gibt. Dann bleiben ausländische Delegationen und Regierungsvertreter ostentativ Banketten und offiziellen Einladungen fern; die Sportler:innen dürfen kommen.
Jüngstes Beispiel ist das WM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und Israel, das für kommenden Dienstag in Udine angesetzt ist. Die linke, palästinafreundliche italienische Partei "Possibile" will bereits 27.000 Unterschriften von Menschen gesammelt haben, die fordern, das Spiel zu canceln. Udines Bürgermeister Alberto Felice de Toni reagierte laut der Kleinen Zeitung folgendermaßen: "Als Bürgermeister habe ich das kollektive Gefühl der Bevölkerung aufgegriffen und war der Meinung, dass es angesichts eines dramatischen Krieges nicht angebracht wäre, am 14. Oktober zu spielen."
"Die Stimmen für schärfere Maßnahmen bis hin zum Boykott gegenüber Israel auf der internationalen Bühne haben nicht nur zugenommen, sondern sind mehrheitsfähig geworden, nicht zuletzt in Europa", kommentiert der Berliner Antisemitismusforscher Marcus Funck in einem Interview mit dem RBB das Vorhaben, Israel möglicherweise ganz von großen Sportveranstaltungen auszuschließen.
Boykotte gibt es gegen viele Länder: In der Wissenschaft wurden Kooperationen mit russischen Forschungseinrichtungen als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine eingefroren; diskutiert wird, ob Forschungsergebnisse russischer Wissenschaftler:innen überhaupt noch in der westlichen Welt publiziert werden sollen.
Das "Philosophie Magazin" erinnert an weitere legendäre Boykott-Aufrufe, darunter "den von Gandhi initiierten Boykott der kolonialen Salzsteuer in Indien, den 1955 von Martin Luther King angestoßenen Busboykott von Montgomery, mit dem gegen rassistische Diskriminierung protestiert wurde, den internationalen Boykott gegen die Marke Outspan in den 1970er Jahren, der sich gegen die Apartheid in Südafrika richtete.
Wie wirksam sind Boykotte gegen Länder oder Firmen? Haben Sie sich schon einmal einem Boykott-Aufruf angeschlossen und warum? Wie beurteilen Sie die Politisierung des Eurovision Song Contest? Ist es richtig, etwa russischen Künstler:innen keine Bühne im Westen mehr zu bieten, sofern sie nicht politisch klar Stellung beziehen?
Alexander Musik diskutiert mit Dr. Emil Brix, Historiker und ehemaliger Direktor der Diplomatischen Akademie Wien und Dr. Daniela Strigl, Literaturwissenschaftlerin und Autorin über Cancel Culture und die Macht und Ohnmacht von Boykotten in Sport, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Wie immer sind Sie eingeladen mitzudiskutieren: Anrufe kostenlos aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79, E-Mails an punkteins(at)orf.at
Sendereihe
Gestaltung
- Alexander Musik
Playlist
Komponist/Komponistin: Billy Rose, Lew Brown & Ray Henderson
Titel: Don't Bring Lulu
Ausführende: The Andrews Sisters
Länge: 02:45 min
Label: Decca
Komponist/Komponistin: George Gershwin & Ira Gershwin
Titel: Let's Call the Whole Thing Off (davon 15 Sek. unterlegt)
Ausführende: Billie Holiday
Länge: 03:21 min
Label: Columbia
Komponist/Komponistin: Cole Porter
Titel: Miss Otis Regrets (She's Unable to Lunch Today)
(davon 58 Sek. unterlegt)
Ausführende: Ella Fitzgerald
Länge: 02:59 min
Label: Verve