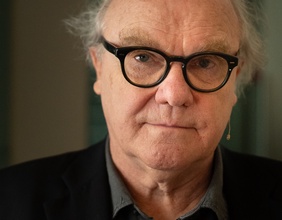Begegnung auf Augenhöhe?
Ethnotourismus
Immer mehr Menschen begeben sich als Urlauberinnen und Urlauber auf die Suche nach dem angeblich Ursprünglichen in möglichst exotische Weltgegenden. Über Chancen und Probleme dieses sogenannten "Ethnotourismus" gibt nun ein Sammelband Auskunft.
8. April 2017, 21:58
Am Anfang steht immer der Hang zu Exotik, Authentizität und Exklusivität. Auch bei professionellen Touristen wie Sozialanthropologen und anderen Berufs-Reisenden. Der Geograf Alexander Trupp etwa reiste vor einigen Jahren ins abgeschlossene, diktatorisch regierte Burma, wo er und seine Reisebeleiter glaubten, nur wenige Touristen anzutreffen.
Ein Trekking Guide, der echte, ursprüngliche Kulturen verhieß, war schnell gefunden. Doch schon nach ein paar Stunden Marsch durch den Dschungel verflog die Abenteuerlust der Studenten. Heftiger Monsunregen setzte ein, Tausende Blutegel wurden zu ständigen Begleitern. Als man am nächsten Morgen das heiß ersehnte Bergdorf erreicht hatte, setzte es eine weitere herbe Enttäuschung: Anstatt der imaginierten traditionellen Hütten fand man Wellblechhütten vor, aus denen Radiostimmen ertönten. Als dann der traditionelle Medizinmann noch um ein Aspirin fragte, verlor die Gruppe vollends die Fassung und begann untereinander zu streiten.
Das Wissen über die Anderen
Die interkulturelle Begegnung beim Ethnotourismus beschränkt sich oft nur auf ein paar Minuten, seltener sind es Stunden oder gar Tage. In diesem Zeitraum werden zwar den Touristen gewisse Einblicke in den Alltag der fremden ethnischen Gruppe vermittelt, den Bereisten ist hingegen die Einsicht in das Alltagsleben der Kultur der Besucher nicht möglich. Von Begegnung auf Augenhöhe kann also keine Rede sein, so der Tenor der meisten ethnotouristischen Studien.
Alexander Trupp hat im Jahr 2006 bei den Akha in Thailand eine Feldforschung durchgeführt und kam zu einem anderen Ergebnis:
Insbesondere dort, wo Ethnotourismus zum alltäglichen Phänomen wurde und die interkulturelle Begegnung auf einige Minuten beschränkt bleibt, ist das Wissen der bereisten Bevölkerung über die Touristen größer als als vice versa.
Minderwertigkeitsgefühle gegenüber Besuchern
Den afrikanischen Himba widmet Eberhard Rotfuß, Anthropogeograph an der Universität Passau, seinen Beitrag mit dem Titel "Interkulturelle Begegnung zwischen Stolz und Scham." Die Himba sind halbnomadische Rinderhirten der Trockensavannen und Halbwüsten Namibias. Als die ockerfarbenen Nomaden bedienen sie durch ihr exotisch anmutendes Aussehen und durch ihre soziokulturelle Praxis die Imaginationen der Reisenden. Jährlich rund 20.000 Besucher gehen auf Abenteuerfahrt zu dem angeblich ungestört und in Symbiose mit der harschen Natur Afrikas lebenden Volk.
Die Himba zeigen anderen ethnischen Gruppen gegenüber traditionell ein Gefühl der Überlegenheit, was im Besitz von vielen Rindern begründet ist. Dazu komme in den letzten Jahren noch der Stolz hinzu, die Auserwählten der Touristen zu sein. In Kontrast dazu, so Eberhard Rotfuß, werde die Eigenbeurteilung von einem Eindruck der Minderwertigkeit überschattet. Diese äußere sich in einem offensichtlichen Komplex und einer empfundenen intellektuellen und ökonomischen Schwäche gegenüber der Gruppe der Touristen.
Die Touristen leben gut, ihr Lebensstil ist über unserem. Wir, die Schwarzen, sind in Armut geboren, die Touristen sind dort, wo Macht und Kraft ist. Sieh, sie haben Autos, die uns transportieren können. Wir nicht. Wir sind lediglich dumme Affen, die an ihren Füßen sind.
Ist Ethnotourismus nun generell als asymmetrische Begegnung zu verdammen oder als finanzielle Quelle auch positiv zu bewerten? Allgemeingültige Aussagen lassen sich in diesem Spannungsfeld von "Zurück zur Natur"-Komplex, Neugier und Abenteuer nicht so einfach treffen, erklärt Herausgeber und Ethnologe Alexander Trupp.
Die Fernsten sind die Interessantesten
Die Ethnologin Ingrid Thurner verdeutlicht in ihrem der eigenen Berufsgruppe der Wissenschaftler gegenüber sehr kritischen Beitrag mit dem Titel "Bereist. Beforscht", alle seien Fernreisenden jene Kulturen, die sich am meisten von der eigenen unterscheide, denn diese seien die faszinierendsten.
Die Menschen, die das Ziel der Reise sind, werden als ethnologisch interessant bereist und beforscht, als folkloristisch dekorativ fotografiert, aber als Minderheiten sind sie politisch marginalisiert, außerdem ökonomisch depriviert, denn sonst stünden sie nicht als Reiseziel zur Verfügung.
Das Aufeinandertreffen sei durch ein Machtungleichgewicht geprägt, das durch Geld vorübergehend aufgehoben werde. Das Gefälle verringere sich jedoch nicht, so Ingrid Thurners Schluss.
Dieses Gefälle besteht unabhängig davon, ob Reisende und Bereiste oder Forschende oder Beforschte aufeinander treffen!
Service
Claudia Trupp, Alexandra Trupp, "Ethnotourismus. Interkulturelle Begegnung auf Augenhöhe?", Mandelbaum Verlag
Mandelbaum Verlag - Ethnotourismus
Übersicht
- Tourismus