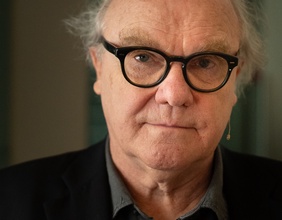Die "Entthronung" Joseph Conrads
Fahrt ins Geheimnis
Der Blick aus der Nähe, so wie der Leipziger Anglist Elmar Schenkel ihn vornimmt, birgt eine Ent-Täuschung im wahren Wortsinn: Leser, die Joseph Conrad, den Autor großartiger Literatur als großartigen Menschen verehren, werden ihrer Täuschung beraubt.
8. April 2017, 21:58
Obwohl seit 20 Jahren Biografien über große Frauen und Männer mehr der Wahrheit verpflichtet sind als der Heldenverehrung, erstaunt es immer wieder, dass ein Mensch in der Kunst Großes schaffen kann und in der alltäglichen Wirklichkeit allzu klein ist: ängstlich, streitsüchtig, herrisch und eifersüchtig. Auch Conrads Biograf Elmar Schenkel schreibt in einem Kapitel, in dem es um Conrads Herr-und-Knecht-Verhältnis zu seiner Frau Jessie geht, empört:
Man fragt sich bei Autoren oft, ob nicht der größte Teil ihrer Humanität sozusagen vor der Welt durch eine große Zeitung verdeckt ist, genauer gesagt durch das umfangreiche literarische Opus. Da wird Empathie mit erfundenen Figuren geübt, ein endloses Sich-Hineindenken in alle möglichen Lebensläufe, nur eben nicht in die, die einen täglich umgeben.
Geburtsdatum unklar
Wer den feinen, scharfen und atmosphärisch pointierten Stil Joseph Conrads liebt, den irritieren Leutseligkeiten, grammatikalische Ungereimtheiten und sonstige Stilblüten von Professor Dr. Elmar Schenkel. Zum Beispiel wenn er über Joseph Conrads unklares Geburtsdatum schreibt:
Auch das kann als Symptom gelesen werden: für die schwierige historische Ausgangslage, die dieses Individuum vorfand und die es ihm schließlich verbat, sich in ihr zu verwurzeln.
Ein Trost, solche Stilblüten finden sich tendenziell eher im ersten Viertel der Biografie. Hat man das hinter sich gelassen, dürfen die Früchte der Langmut geerntet werden: Schenkel hat viel gelesen, einen Haufen Sekundärliteratur, andere Biografien über Conrad, die nicht unerhebliche Zahl an Nachdichtungen und Weiterdichtungen der Erzählungen Conrads. Er beobachtet die Wirkungen, die die Schriften des Autors in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten hatten und noch wichtiger als sein Fleiß: Er liebt das Werk Conrads.
Klassiker "Herz der Finsternis"
In den Mittelpunkt der Conradschen Wirkungsgeschichte stellt Schenkel die Novelle "Herz der Finsternis", erschienen 1899. Joseph Conrad verarbeitet in seinem Weltklassiker eine Schiffsreise durch den belgisch besetzten Kongo, die er neun Jahre zuvor als Kapitän angetreten hatte.
Den Fluss hinaufzufahren war wie eine Reise zurück zu den frühesten Anfängen der Welt, als noch die Pflanzen zügellos die Erde überwucherten und die großen Bäume Könige waren. Ein leerer Strom, ein großes Schweigen, ein undurchdringlicher Wald. Die Luft war warm, schwer, drückend, träge. Im Glanz des Sonnenscheins war keine Freude. Die langen Abschnitte des öden Flusslaufs führten tiefer und tiefer in die Düsternis der beschatteten Ferne hinein. Auf den silbrigen Sandbänken sonnten sich Seite an Seite Flusspferde und Alligatoren. An den breiteren Stellen strömte das Wasser zwischen einer Unzahl bewaldeter Inselchen hin; auf jenem Fluss konnte man in die Irre gehen wie in einer Wüste und stieß beim Versuch, das Fahrwasser zu finden, fortgesetzt auf Sandbänke, bis man endlich glaubte, man sei verhext und für immer von allem abgeschnitten, was einem einst vertraut war - irgendwo - weit fort - in einer anderen Existenz.
Der Erzähler, Marlow, berichtet in "Herz der Finsternis" von seiner Aufgabe, den erkrankten Stationsdirektor und legendär erfolgreichen Elfenbeinjäger Kurtz aus dem Inneren des Landes zu holen. Nach einer unheimlichen Reise durch den "filzigen, grimmen Dschungel", während der die Schiffsbesatzung auch noch von Eingeborenen angegriffen wird, findet Marlow die Siedlung von Kurtz. Es stellt sich heraus: Kurtz hat ein übles Terrorregime im Busch etabliert. Er lässt sich als Gott anbeten und fordert Menschenopfer.
1899, ein Jahr vor Freuds "Traumdeutungen" erschienen, wirkt Conrads "Herz der Finsternis" wie das Erwachen des Unbewussten in der Literatur. Der Urwald als Seelenlandschaft, ein Dickicht aus archaischen Begierden. Die Wilden als unsere gar nicht so entfernten Verwandten, tierhafte Bestialität als Bestandteil unserer Psyche.
Dieser gleichnishafte Roman ist - wie die Märchen - ins kollektive Menschengedächtnis eingegangen, beschreibt er doch als einer der ersten die brutale Gier der Kolonisatoren. "Historisch sind wir in den Bannkreis einer neuen Unmenschlichkeit eingetreten", schreibt Elmar Schenkel, "eine erste Vorahnung dessen, was bald Konzentrationslager heißen sollte." Nicht umsonst gibt es allein neun deutsche Fassungen von "Herz der Finsternis".
Benehmen, Bowler, Bildung
Wie ist dieser Joseph Conrad, der eine derart unsterbliche Literatur schrieb, aufgewachsen? Sein Vater, ein polnischer Adliger, Literaturliebhaber und gescheiterter Gutsbesitzer, kämpft Mitte des 19. Jahrhunderts für die Landreform und die Abschaffung der Leibeigenschaft. Zusammen mit seiner Frau, Joseph Conrads Mutter.
Beide werden von den Russen wegen Hochverrats angeklagt und 500 Kilometer nördlich von Moskau in die Verbannung geschickt. Dort übersetzt der Vater Shakespeare, der kleine Joseph muss Dickens auswendig lernen. Als er sieben ist, stirbt die Mutter in der Fremde an Tuberkulose. Vier Jahre später der Vater. Mit elf ist Conrad Vollwaise und kommt zu einem Onkel mütterlicherseits, einem ehrbaren, aber herzlosen Mann, wie es heißt.
Dann die Flucht vorwärts: Mit 16 wird Joseph Conrad Matrose und fährt zehn Jahre zur See. Ironisch redet man in den Häfen vom "russischen Grafen": perfektes Benehmen, Bowler, Bildung. Die Menschen spüren seine Andersartigkeit. Dann entscheidet er sich für die Schriftstellerei, heiratet, quält sich mit Rheuma und Gicht und dem Schreiben. Drei Sätze an einem Tag sind ein nicht unübliches Arbeitspensum. Er schreibt in Englisch. Seine Frau Jessie ist eine 16 Jahre jüngere Sekretärin und Tochter einer kinderreichen Familie. Aus Jessies beiden biografischen Werken zitiert Schenkel, wie sehr Conrad aufs Bemuttertwerden und auf Unterordnung bestand.
Die Menschlichkeit zurückgeben
Worauf er auch bestand, war, die frühen Ereignisse seines Lebens ruhen zu lassen. Er wollte auf keinen Fall psychologisch werden. Er fürchtete eine zerstörerische Macht der Psychologie, die durch Freud und seine Schüler damals auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war. Conrad wollte die Dinge vielleicht nicht auf Muster, Mechanismen und Traumata reduzieren, für ihn wäre es ein Banalisieren gewesen.
"Der Blick aus der Nähe entthront das Genie", schreibt Elmar Schenkel. Seine Biografie Joseph Conrads ist eine sehr zartfühlende Entthronung, die dem literarischen Star seine Menschlichkeit zurückgibt. Sehr schade, dass es diese vielen stilistischen Schnitzer gibt. Auch Professoren brauchen einen Lektor. An dieser Stelle wäre dem Fischer Verlag vielleicht auch noch diese und jene Illusion zu nehmen.
Hör-Tipp
Ex libris, jeden Sonntag, 18:15 Uhr
Buch-Tipp
Elmar Schenkel, "Fahrt ins Geheimnis. Joseph Conrad, eine Biografie", S. Fischer Verlag
Link
S. Fischer Verlag - Fahrt ins Geheimnis