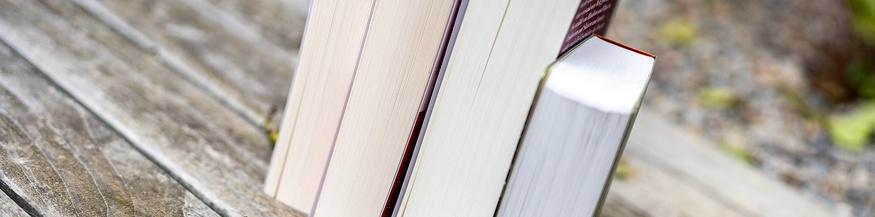Cyberflüchtlinge
Risse in der japanischen Gesellschaft
Japan gehört nach wie vor zu den reichsten Ländern der Welt. Doch der neoliberale Kurs, den Japan seit einigen Jahren fährt, zeigt Folgen: die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer, und immer mehr Menschen können von ihren Jobs nicht mehr leben.
8. April 2017, 21:58
Schlecht riechenden Menschen und Leuten mit unsauberer Kleidung ist der Eintritt verboten, warnt ein Schild am Eingang zu einem Internetcafe. Dabei bräuchte das schäbige Etablissement selbst dringend ein Facelifting. Die Luft ist abgestanden und verraucht. Die Kabine ist winzig: ein niedriges Sofa mit braunem, schäbigem Bezug, auf einem Tischchen davor ein PC.
Die Benutzung kostet je nach Package zwischen 70 Cent und 25 Euro, Getränke inbegriffen. Im Zehn-Stunden-Tarif ist die Dusche inkludiert. Immer mehr Menschen können sich auf dem hochpreisigen Immobilienmarkt keine Wohnung leisten. Und so werden die Internetcafes zunehmend zu Notunterkünften. Ein Schock ging durchs Land, als das japanische Gesundheitsministerium 2006 Schätzungen veröffentlichte, wonach rund fünfeinhalbtausend Menschen in Internetcafes leben - vor allem junge Leute bis 35, die keinen fixen Job haben oder Tagelöhner. Die Medien haben für sie den Ausdruck: netkafe nanmin - Internetcafeflüchtlinge - geprägt.
Der soziale Abstieg
Der 38-jährige Kazufumi Kinjo hatte jahrelang für rund fünf Euro die Stunde als Tagelöhner am Bau gearbeitet. Heute ist er körperlich und psychisch am Ende. Familiäre Unterstützung bekommt er nicht. Geboren wurde Kazufumi Kinjo in Japans südlichster Präfektur Okinawa, dem Armenhaus Japans. Mit 17 schmiss er die Mittelschule und ging nach Tokyo. Dort wohnte er zunächst in der Arbeiterbaracke der Baufirma. Dann mietete er eine kleine Wohnung.
Irgendwann wurde seine Mutter schwer krank. Er bezahlte ihre Medikamenten - und Krankenhausrechnungen, bis er seine eigene Miete nicht mehr zahlen konnte und auf der Straße stand. Wenn er Geld hatte, übernachtete er im Internetcafe. Arbeit fand er nicht mehr: "Wenn man in der japanischen Gesellschaft einmal unten ist, kommt man nie wieder hinauf." Heute lebt er von der staatlichen Sozialhilfe von rund 880 Euro und teilt sich mit einem Freund ein Zimmer in der Präfektur Saitama.
Fehlendes soziales Netz
Das bisherige japanische Sozialsystem passe nicht zur neuen Zeit des Neoliberalismus, meint Yuki Honda von der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tokyo. Denn bis die 1990er Jahre sorgten die großen Firmen für die soziale Sicherheit ihrer Angestellten, seither aber sinkt die Zahl der Fixangestellten und damit derer, die den sozialen Schutz der Firmen genießen: "Da gleichzeitig ein staatliches Sicherheitsnetz fehlt, hat sich die Zahl der sozialen Verlierer drastisch erhöht."
Jobhopper
Während sich noch vor einigen Jahren die Firmen um Universitätsabsolventinnen und -Absolventen rissen, findet heute ein Drittel nur mehr unregelmäßíge Beschäftigung, mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 11.000 Euro. Das reicht in Japan nicht zum Leben.
Die Armutsgrenze liegt bei 14.500 Euro. Die freeta, wie die Jobhopper in Japan genannt werden, hanteln sich von einem McJob zum nächsten, bei Stundenlöhnen von rund fünf Euro.
Mindestlohnerhöhung gefordert
Nach einem OECD-Bericht 2006 ist die relative Armutsrate in Japan eine der höchsten im OECD-Raum. Schuld an der zunehmenden Ungleichheit ist demzufolge auch die rapide alternde Gesellschaft - derzeit kommen drei Viertel der Sozialausgaben den Alten zugute.
Schuld am neuen Phänomen der Working Poor sei der zu niedrige Mindestlohn, sagt die Gewerkschaft. Der Mindestlohn ist regional unterschiedlich und liegt bei 5,20 Euro pro Stunde in Tokyo und 4,40 Euro in Okinawa. Der Gewerkschaftsdachverband fordert eine Vereinheitlichung und Erhöhung auf 7,30 Euro.
Hör-Tipp
Journal-Panorama, Dienstag, 11. November 2008, 18:25 Uhr