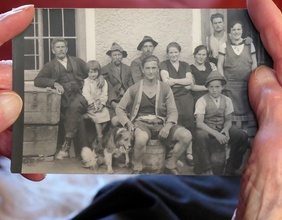Eine problematische Beziehung
Schumann und die Oper
Eine einzige Oper, "Genoveva", die die Zeitgenossen als "symphonisch" und "undramatisch" vor den Kopf gestoßen hat und bis heute kein Repertoirestück geworden ist, dagegen "opernhafte" Momente in den Oratorien: Über Robert Schumanns problematische Beziehung zum Musiktheater.
27. April 2017, 15:40
Ruth Ziesak als Genoveva
Ein "verhinderter Opernkomponist"?
"Eine Oper soll das nächste sein, und ich brenne darauf", lautet ein Eintrag in Robert Schumanns Tagebuch kurz vor der Uraufführung seines op. 50 in Leipzig, "Das Paradies und die Peri". Schon als Jugendlicher hatte Schumann Thomas Moores Orient-Epos "Lalla Rookh" mit der Nacherzählung einer persischen Legende von einer Frau, die als Kind eines gefallenen Engels und einer Sterblichen aus dem Paradies ausgeschlossen ist, aber mithilfe guter Taten dort Einlass finden möchte, kennen gelernt.
Damals dachte er daran, die drei Heilungs- und Errettungswerke der Peri zu drei Opernakten werden zu lassen - Richard Wagner erging es ähnlich. Wagner an Schumann: "Ich kenne dieses wundervolle Gedicht nicht nur, sondern es ist mir auch schon durch meinen musikalischen Sinn gefahren; ich fand aber keine Form, in welcher das Gedicht wiederzugeben sei".
Neue Welt in oratorischer Form
Die oratorische Form, die sich Robert Schumann für "Das Paradies und die Peri" fand, sollte eine "neue Welt" eröffnen: Nichts Geistlich-Protestantisches, nicht mehr oder weniger bei Händel und Haydn anknüpfend (ein Seitenhieb auf Spohr, Loewe und Mendelssohn), nichts "für den Betsaal", dafür ein Oratorium "für heitre Menschen", "ein neues Genre für den Konzertsaal".
In einem von Clara Schumann fast ängstlich beobachteten Schaffensrausch von Robert Schumann entstand "Das Paradies und die Peri" 1843: "Mich dünkt es das Herrlichste, was er je geschrieben. Er arbeitet aber mit Leib und Seele daran, mit einer Glut, daß mir zuweilen bangt, es möchte ihm schaden; und doch beglückt es mich auch wieder."
Marjana Lipovsek als Margareta
Beglückende "Peri", enttäuschende "Genoveva"
Das Stück machte Furore und weckte Erwartungen auf eine Oper aus Robert Schumanns Feder. Auch Schumann selbst zielte auf eine "große deutsche Nationaloper" als Synthese von deutscher Romantik und französischer Grand Opéra. Den Stoff dafür fand er nach langer Suche, während der er rund 50 andere Projekte wieder verwarf, in der davor von Ludwig Tieck für die Bühne bearbeiteten Legende von "Leben und Tod der heiligen Genoveva".
In der für ihn typischen Art, begeistert von Friedrich Hebbels "Genoveva"-Drama von 1841, warf Schumann die Ouvertüre zu seiner "Genoveva"-Oper an einem einzigen Tag, dem Gründonnerstag 1847, aufs Papier. Der Bann war gebrochen, doch die Erwartungen sollten, wie Richard Wagner formulierte, "bizarr" enttäuscht werden.
"Genoveva" als "Lohengrin"-Parallelstück
Es gibt Parallelen zwischen Schumanns "Genoveva" und dem zur gleichen Zeit entstandenen "Lohengrin", der so wie "Genoveva" 1850 uraufgeführt wurde - "Lohengrin" in Weimar, "Genoveva" in Leipzig. Die "Genoveva"-Titelrolle ist eine Elsa-Figur, mit einer Ortrud-ähnlichen Gegenspielerin in Margaretha. Nur Schumanns Opern-Siegfried, Pfalzgraf von Brabant, ist weit von Wagners späterem Festspielbühnen-Helden entfernt...
Margaretha war Genovevas Amme, wurde von Siegfried vom Hof entfernt, ist nun der schwarzen Magie ergeben und sieht ihre Stunde schlagen, als Siegfried, auf Feldzug, Genoveva der Obhut von Golo überlässt. (Mit der Aufforderung an Genoveva: "Du bist ein deutsches Weib, so klage nicht!")
Golo liebt Genoveva heimlich und lässt sich von Margaretha zu einem Liebesgeständnis drängen, das Genoveva mit dem entsetzten Aufschrei "Ehrloser Bastard!" quittiert. Nun treten Intrigen und Zauberei in Aktion, Genoveva wird ein falscher Liebhaber angedichtet, der in Straßburg krank darniederliegende Siegfried mit Giftanschlägen traktiert.
Wenn im letzten der vier Akte düstere Henkersknechte Genoveva in eine wüste Felsenschlucht verschleppen und dabei anspielungsreich Obszönes singen, scheint die Wendung zum Guten in unerreichbarer Ferne - aber sie kommt, mit betrüblichem Spannungs-Decrescendo.
Ein "ununterbrochener Strom" von Musik
Wann immer Nikolaus Harnoncourt, der sich bei der Styriarte in Graz in den 1990er Jahren und danach auch noch für eine Bühnenproduktion am Opernhaus Zürich gemeinsam mit Regisseur Martin Kusej mit "Genoveva" beschäftigt hat, diese Soloszene der Genoveva dirigiert, kostet er die schweifenden, sich im Lyrischen verlierenden Melodien noch zusätzlich aus, mit denen Robert Schumann die seelisch vergewaltigte Figur leiden, bitten und zu Himmelschören in Todesangst vor einem Kreuz niederbrechen lässt.
Magische Monologe und der symphonische Fluss, mit schroffen Akzenten dazwischen, als "Schicksalsstrom", diese Sprachbilder hat Harnoncourt gefunden, um die Eigenart von Schumanns "Genoveva"-Musik zu erklären. Denn bei einem Publikum, das nicht darauf vorbereitet ist, keine "normale" Oper vorzufinden, kann "Genoveva" trotz der Fülle an Geschehnissen, trotz der dramatischen "Würze", die die Person der Margaretha einbringt, auch heute noch als quälend undramatisch und zugleich symphonisch überladen ankommen.
"Fremdartig und schwierig ist in der Oper", schrieb der Schumann-Zeitgenosse und spätere Mozart-Biograph Otto Jahn in seiner "Genoveva"-Kritik, "dass kaum irgendein Musikstück in der gewohnten Weise abgeschlossen sich selbständig herauslöst, sondern so weit der stetige Zusammenhang der Handlung reicht, geht die Musik in einem ununterbrochenen Strom fort. Das Richtige und Wahre darin ist leicht zu erkennen, aber dem Zuhörer wird eine große Anstrengung zugemutet und dem Sänger die Möglichkeit des momentanen Beifalls abgeschnitten. Dazu kommt, daß kein Moment als Nebensache aufgefasst ist, jeder einzeln charakterisiert und mit Liebe behandelt; auch das ist an sich ja vortrefflich, erschwert aber die Auffassung."
Eigenarten, die der "Genoveva" nach einhelliger Kritikermeinung das Genick brachen - man fühlt sich ans Aufstöhnen in Anbetracht der Unerhörtheiten Richard Wagners erinnert, mit seinen "durchkomponierten" Oper und "endlosen Melodien" ... Eduard Hanslick etwa sah die Sängerinnen und Sänger "in einer Falte des weit aufgebauschten Orchesters" verschwinden. Die Enttäuschung war groß, ließ Robert Schumann alle weiteren Opernpläne verwerfen und überschattet bis heute die "Genoveva"-Rezeption.
Oratorium und Chorballade
In der musikalischen Gestaltung mag "Genoveva" ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus sein. (Für Nikolaus Harnoncourt ist sie ein Stück, in dem sich Orchester-betonte Musik auf eine gänzlich neue, Norm-fremde, fortschrittliche Weise mit dem Theater verbindet, trotz des vorherrschenden lyrischen Grundtons, der auch in Schumanns Oratorien herrscht.) Als Figur ist sie, so wie schon die Peri in Schumanns "Paradies und die Peri", ein Kind ihrer Zeit: weibliche Zartheit in höchster Verklärung, von der Selbstlosigkeit, die es braucht, um eigene wie fremde Schuld zu tilgen - eine rührende Dulderin, so wie Carl Maria von Webers "Euryanthe", so wie Wagners Tannhäuser-Elisabeth.
Auffallend, dass der romantische Sujet-Typus "Erlösungsoper", der sich von Heinrich Marschners "Hans Heiling" über den "Fliegenden Holländer" bis zum "Lohengrin" zieht, im Oratorium sogar deutlicher durchschlägt. Auch wird, wer "Melodien" braucht, in "Das Paradies und die Peri" leichter fündig als in "Genoveva". Geht es nach dem Dresdner Musikwissenschaftler Helmut Loos, zeigen überhaupt die kaum je gespielten späten Chorballaden am besten Robert Schumanns "opernhafte" Seite: "Des Sängers Fluch" und "Der Königssohn" - "kleine realistische Opern".
Service
Helmut Loos, "Robert Schumann. Werk und Leben", Edition Steinbauer