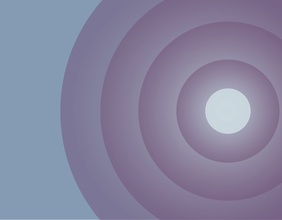Der Donaupark
"Ganz ohne Zweifel, die Stadt Wien hat da so etwas wie ein neues Weltwunder zustande gebracht", stand in der "Arbeiterzeitung" vom 15. April 1964 über den Donaupark, wo von April bis Oktober 1964 die Wiener Internationale Gartenschau stattfand.
27. April 2017, 15:40
Der Donaupark ist heute ein beliebtes Naherholungsgebiet, gelegen zwischen der Alten und der Neuen Donau, am Rande der heute mit Wolkenkratzern bebauten Donauplatte. Das markanteste Bauwerk, das im Rahmen der Gartenschau, kurz WIG 64 genannt, errichtet wurde, ist der Donauturm – mit 252 Metern ist er immer noch das höchste Gebäude Österreichs.
Ein weiteres Gebäude der Gartenschau, das ehemalige Seerestaurant am künstlich angelegten Iris-See, wird seit Sommer als Kulturhaus der koreanischen Gemeinde genützt, die den denkmalgeschützten Pavillon aufwändig restauriert hat.
Kulturjournal, 01.03.2013
Hunderte Krähen sitzen in den Baumwipfeln im Donaupark, ein paar Jogger sind unterwegs und auf einem Freiluft-Schachbrett spielt eine Runde älterer Herren mit kniehohen Plastik-Spielfiguren. Die Herren erinnern sich noch an die Zeit, als hier kein Park war, sondern eine Mülldeponie. Und sie erinnern sich an die Wiener Internationale Gartenschau, für die das Gelände instand gesetzt und in einen weitläufigen Park verwandelt wurde. Einer der Schachspieler erzählt, er sei schon 1963 regelmäßig hergekommen, um den Bau des Donauturms zu verfolgen.
Vereinzelt findet man bauliche oder skulpturale Überbleibsel von 1964. Etwa eine Mauer mit buntem Mosaik eines ehemaligen Vogelhauses, oder Werbung für eine Garten-Zeitschrift an der Wand eines Pavillons. Und es sind nicht nur solche Details, die auf die Zeit der Errichtung, Mitte der 1960er Jahre, verweisen, sondern auch die gesamte Anlage, erläutert die Landschaftsarchitektin Lilli Licka: "Diese Art der Darstellung des gestalteten Freiraums und Parks, mit dem Anspruch, am Zug der Zeit zu sein und die internationalen Trends umzusetzen, das hat diesen Meilenstein der Parkanlage eigentlich ermöglicht."
Neues Leben für devastierte Flächen
Die Internationale Gartenschau kann mit einer Weltausstellung für Garten und Landschaft verglichen werden. Ein Zweck solcher Großveranstaltungen, die vor allem in Deutschland und Holland Tradition hatten, war es, im Krieg zerstörte oder devastierte Flächen als Parkanlagen nutzbar zu machen, ihnen ein neues Bild zu geben und zugleich modernen Nutzungsansprüchen gerecht zu werden.
Neben verschiedenen Fachveranstaltungen, gab es Schauen für Erwerbsgartenbau, mit Blumen, Gehölzen, Sträuchern, Obst und Gemüse. Für die Gärten der Nationen entwarfen internationale Landschaftsarchitektinnen Gartenanlagen auf der Höhe der Zeit. Brasilien wurde etwa von Roberto Burle Marx vertreten, einem brillanten Landschaftsplaner, dessen Parks und Gärten das Erscheinungsbild des modernen Brasilien prägen. Bei der Arbeiterstrandbadstraße gab es von Burle Marx Bänke, tropische Pflanzen und eine Wasserwand.
"Soziales Grün"
Die Landschaftsarchitektinnen Ulrike Kruppner und Lilli Licka forschen an der Universität für Bodenkultur über den Donaupark, seine Geschichte und Gegenwart. Mit über zwei Millionen Besuchern der WIG 64 war das Projekt in jedem Fall erfolgreich; ein Anliegen war den Initiatoren jedoch auch die Nachnutzung des Parks als Freifläche für die Stadtbewohner/innen. Sie sprachen vom "sozialen Grün", das zu Verbesserung der Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener beitragen sollte - was der Donaupark bis heute schafft.
In der Gesamtkonzeption funktioniert der Donaupark heute noch wie vor fünfzig Jahren. Für einzelne Bauten, wie Pavillons oder die Seebühne, war keine Nachnutzung vorgesehen. "Diese Dinge sind relativ lange im Park gestanden", sagt Kruppner. "Die Seebühne ist erst 15 oder 20 Jahre später abgetragen worden."
Korea Kulturhaus
HyonJoo Lee heißt uns willkommen im Korea Kulturhaus, das im ehemaligen Seerestaurant im Donaupark untergebracht ist. Frau Lee ist Generalsekretärin des Koreanischen Kulturvereins, der hier ein Teehaus, Unterrichtsklassen und diverse Veranstaltungen betreibt. Das Geld für die notwendige Sanierung aufzubringen, war für die Koreanische Gemeinschaft in Österreich ein großer Kraftakt, sagt Frau Lee. Zwei Millionen Euro hat der Umbau insgesamt gekostet. Durch den Denkmalschutz wurde die Angelegenheit teurer als erwartet.
Bevor die Koreaner die Pflege des Baudenkmals übernommen haben, befand sich darin unter anderem ein Fitnessclub und zeitweilig eine Disco. Nun gibt es hier Unterricht für koreanische und österreichische Kinder, und der große Saal mit Blick auf den See und die Regenbogenbrücke, wird für Veranstaltungen vermietet. Außerdem gibt es ein Teehaus und einen Ausstellungsraum.
1964 wurde das Haus vom Architekten Kurt Schlauss errichtet, der auch andere Donaupark-Bauten entwarf. 2012 wurde es von einem koreanischen Architekten umgebaut. Als Ansprechpartner in Österreich und Vermittler zwischen den Baukulturen war der in Österreich ausgebildete Architekt Byong Hun Lee beteiligt. Zum Denkmalschutz kam eine zusätzliche Herausforderung, sagt er, nämlich, dass das Gebäude eigentlich nicht winterfest war: "Oben haben wir Hebefenster, unten haben wir die alten Originalschiebefenster. Das hat auch so nicht funktioniert und wir mussten es restaurieren."
Koreanische Restaurierung mit Denkmalschutz
Im unteren Stockwerk befindet man sich auf Höhe des Wasserspiegels. Wind, Wasser, Weide – diese drei Elemente des Donauparks sind wichtig in der koreanischen Architektur. Wie das ehemalige Seerestaurant der asiatischen Baukultur angepasst wurde, sieht man am besten draußen. Dem Baukörper wurde ein verglaster, auskragender Raum zugefügt, das Teehaus. Seitlich wurden Betonwände zugefügt, die der koreanischen Tradition der Raumgliederung entsprechen.
Neben den Seepavillon kommt noch ein von einer koreanischen Architektin gestalteter Garten mit Pfirsichbäumen und Seerosen. Nur ein paar Meter weiter ist der 1964 angelegte, abgestufte Rosengarten, der kürzlich erst wieder hergestellt wurde. Und gleich daneben ist ein Spielplatz, dessen Inventar, eine Rakete etwa, teilweise heute noch von der Zukunftsgläubigkeit der 1960er Jahre zeugt.
An den Erfolg von 1964 anschließend, bewarb man sich beim Internationalen Gartenschau-Komitee um eine Neuauflage. Zehn Jahre darauf, 1974 wurde die Wiener Internationale Gartenschau in Oberlaa abgehalten.
Service
Wien.at - Der Donaupark