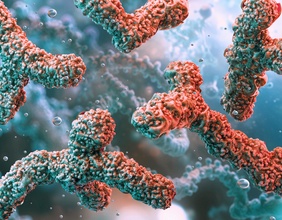Gespräch mit Countertenor Franco Fagioli
Er ist einer der gefragtesten Countertenöre der jüngeren Generation: der Argentinier Franco Fagioli. Er überzeugt besonders in den Opern Georg Friedrich Händels. Mit Händel ist Fagioli heute Abend auch im Rahmen des Osterklang-Festivals im Theater an der Wien zu erleben.
8. April 2017, 21:58

(c) ORF
Kulturjournal, 27.03.2013
Sebastian Fleischer: Franco Fagioli, Sie verkörpern heute Abend den König Salomo, den wir aus dem Alten Testament kennen. Wie ist diese Figur in Händels Oratorium skizziert?
Franco Fagioli: Händel nahm sich drei Szenen her, die man noch heute sehr stark mit Salomo in Verbindung bringt: Im ersten Akt spricht er über den Tempel Jerusalems, den er erbaut hat, im zweiten fällt er sein berühmtes salomonisches Urteil, in dem er aus zwei Frauen, die beide ein Kind für sich beanspruchen, die echte Mutter erkennt, und in der dritten Szene gibt er ein Fest für die Königin von Saba. Es ist also ein gottesfürchtiger und weiser, aber auch sinnlicher König Salomo, der uns in Händels Oratorium begegnet.
Sie feierten Ihre größten Erfolge mit den Opern von Georg Friedrich Händel. Sind seine Partien so etwas wie der Zenit in der Laufbahn eines Countertenors?
Ja, natürlich. Händel ist ein Muss für jeden Countertenor. Seine Werke wurden von den berühmten Kastraten seiner Zeit gesungen, wie Senesino, Caffarelli oder Carestini. Händel verstand es, Virtuosität und Dramatik in seinen Rollen zu vereinen. Das gilt speziell für die Figuren aus seinen Opern, denn wir müssen schon deutlich zwischen den italienischen Opern und den Oratorien unterscheiden. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene musikalische Sprachen. All die italienischen Kastraten zu Händels Zeiten waren auf Oper spezialisiert, Oratorien sangen sie nur gelegentlich. Ich mache es heute ähnlich, wobei mir die Oratorien helfen, ein reichhaltigeres Bild von Händels Musik zu bekommen.
Wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen Oper und Oratorium?
Der Chor spielt im Oratorium freilich eine zentrale Rolle, was diese Werke unglaublich schön macht. Und die Tatsache, dass Händels Oratorien in englischer Sprache sind, wirkt sich auch auf die Musik aus. Da klingen die Rezitative ganz anders als in den Opern. Diese sind wiederum stark von der neapolitanischen Tradition beeinflusst, die die Sänger mitgebracht haben.
Sie haben ja ursprünglich Klavier in Ihrer argentinischen Heimatstadt studiert und sind dann zum Gesang gewechselt. Wann haben Sie den Entschluss gefasst, Countertenor zu werden?
Da war ich 19 Jahre alt. Als Kind habe ich immer in Chören gesungen. Das hat mich geprägt. Später habe ich selbst einen Chor mit Jugendlichen gegründet und geleitet. Ich habe immer automatisch in hohen Lagen gesungen, wusste aber nicht, dass man das auch professionell machen kann. Ich habe immer gedacht, ich imitiere nur einen Sopran oder eine Alt-Stimme. Bis ich mir Pergolesis "Stabat Mater" auf CD gekauft habe. Ich habe mir das angehört und gedacht: Der singt ja genauso wie ich. Also kann ich auch Countertenor werden! Das war für mich der auslösende Moment.
Wie kommt man dahinter, ob man geeignet ist, Countertenor zu werden?
Ich kann nicht sagen, ob es körperliche Voraussetzungen gibt, die die Herausbildung einer hohen Singstimme begünstigen. Die Zeiten, in denen solche Voraussetzungen durch operative Eingriffe geschaffen wurden, sind natürlich vorbei. Es gibt freilich eine natürliche Veranlagung. Nicht jeder kann Countertenor werden, auch wenn alle Menschen eine Kopfstimme haben. Natürlich gibt es wenige Countertenöre als Sänger in anderen Stimmlagen. Das liegt aber vor allem daran, dass diese Art des Gesangs im 19. Jahrhundert vollkommen aus der Mode gekommen ist. Im Barock hat es unglaublich viele Kastraten gegeben. Heute wollen sich wieder mehr und mehr junge Menschen zum Countertenor ausbilden lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen soll, denn ich profitiere natürlich ein Stück weit von diesem besonderen Nimbus, den Countertenöre auf sich ziehen. Es ist auch etwas Besonderes, aber jeder Künstler sollte den Anspruch haben, Außergewöhnliches zu leisten.
Sie sind 2011 mit dem Premio Abbiati als bester Sänger ausgezeichnet worden, einem der renommiertesten Musikpreise Italiens. Sie waren der erste Countertenor überhaupt, der diesen Preis erhalten hat. Ist das ein Zeichen für Sie, dass Countertenöre in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch wenig präsent sind?
Ja, ich denke schon. Diese Auszeichnung hat mich besonders gefreut, weil gerade in Italien Countertenöre wenig populär sind - oder waren, denn vielleicht ist der Preis ja ein Zeichen gewesen, dass die Leistung von Countertenören immer mehr Anerkennung findet. Heute haben Countertenöre ja ein viel höheres technisches Können als noch vor zwanzig Jahren. Und das ist gut so, denn die Rollen, die sie singen, waren früher den echten Kastraten vorbehalten. Das setzt schon große technische Fertigkeiten voraus. Also dieser Abbiati-Preis war schon ein Zeichen, vor allem, wenn man bedenkt, dass Italien ja die Geburtsstätte dieser Art des Gesangs ist.
Mittlerweile genießen Sie ja eine Popularität, die für Countertenöre sehr ungewöhnlich ist.
Das große Interesse macht mich natürlich sehr glücklich, denn ich liebe das, was ich mache, und ich will es mit möglichst vielen teilen. Das ist ja auch der Grund, warum ich besonders gerne Solokonzerte geben, weil dann kommen die Leute nur, um dich zu hören, und du kannst einen ganz speziellen Kontakt zum Publikum herstellen. Das ist einfach ein schönes Gefühl.
Auch in der zeitgenössischen Musik nehmen Countertenöre an Bedeutung zu. Komponisten wie Philip Glass oder Olga Neuwirth haben Stücke für Countertenöre geschrieben. Wären Sie an einem Ausflug in die Neue Musik oder auch in die Popularmusik interessiert?
Ja, warum nicht? Man müsste sich natürlich jedes Projekt einzeln anschauen. Besonders als Countertenor muss ich darauf achten, Stücke auszuwählen, die gut für meine Stimme sind und ihr nicht schaden. Aber wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, bin ich offen für alles.