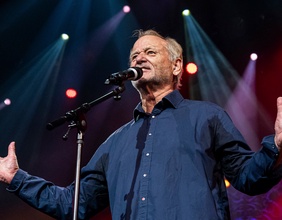WTO-Abkommen - tatsächlich "historisch"?
Es ist die erste große Einigung in der Welthandelsorganisation seit der Gründung der WTO im Jahr 1995. Die WTO-Spitze sieht damit einen historischen Erfolg. Ist das eine euphorische Überzeichnung oder tatsächlich gerechtfertigt? Und was bringt es den Konsumenten in Österreich?
8. April 2017, 21:58
Mittagsjournal, 7.12.2013
Zufriedenheit angebracht
Vom allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT aus dem Jahre 1948 bis zum Papier von Bali ist es wahrlich ein Weg gewesen und die Welt hat sich massiv verändert. Das erklärt ein wenig die Inszenierung des Ergebnisses. Die Verhandler können nach dem tage- und nächtelangen Feilschen mit dem Ergebnis unter dem Strich diesmal aber wirklich zufrieden sein. Erstens, weil es überhaupt ein Ergebnis gibt - es ist das erste globale Handelsabkommen, das die 18 Jahre alte Organisation erreicht hat. Zweitens weil das Kunststück gelungen ist, viele verschiedene Interessen zu bündeln. Bezeichnend ist der zum Teil heftige Streit vor allem zwischen Indien und Vertretern der USA sowie der EU um Agrarsubventionen, eine Auseinandersetzung zwischen zwei hoch entwickelten Regionen und einem so genannten Schwellenland.
Impulse durch weniger Regeln
Angeblich sollen die in Bali gelungenen Beschlüsse weltweit Wirtschaftswachstum im Volumen von 1.000 Milliarden US-Dollar (umgerechnet an die 750 Milliarden Euro) und bis zu etwa 30 Millionen Arbeitsplätze generieren. Um einzuschätzen, wie das funktionieren kann, nützt ein Blick aus der Vogelperspektive, der die globalen Handelsströme leichter erkennen lässt. Diese Handelsströme bekommen gleichsam immer mehr Zuflüsse - Länder wie China, Brasilien oder eben Indien sind zu einem wichtigen Teil des Systems geworden. In den Ländern werden Einzelteile oder gleich ganze Produktgruppen gefertigt (zum Beispiel Fahrzeuge), die Menschen in diesen Ländern sind aber auch Konsumenten. Weniger Bürokratie, niedrigere Zölle, geringerer Protektionismus - kurzum weniger Regeln und mehr Freiraum sollen diesen Wachstumsimpuls auslösen und der schleppenden globalen Konjunktur neuen Schwung geben, von dem besonders Entwicklungsländer, etwa in Asien und Afrika, profitieren sollen. Je abgeschotteter Länder oder Regionen agieren, desto geringer ist die Chance auf mehr Wohlstand für die Armen - so der Ansatz der WTO.
Kritiker sehen Desaster
Globalisierungskritiker wie Attac werten das Ergebnis als Desaster für eine gerechte Welthandelsordnung. So würden von den niedrigeren Zollschranken besonders die exportstarken Industrieländer profitieren. Für die ärmsten Entwicklungsländer, etwa in Afrika, seien die Beschlüsse im Wesentlichen unverbindliche Absichtserklärungen. Soziale und menschenrechtliche Komponenten hätten ohnehin keine oder kaum eine Rolle gespielt. Jedenfalls wird es an der WTO liegen darauf zu achten, dass sich alle an die Regeln halten. Die Organisation war schon bisher bei Handelsstreitigkeiten gefordert und wird es weiterhin sein - Bali ist damit auch in diesem Punkt ein Erfolg für die WTO, weil sie weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen wird.
Beim besonders umstrittenen Abbau von Unterstützungen für landwirtschaftliche Produkte hat es einen Kompromiss gegeben, der Entwicklungsländern wie Indien zumindest befristet doch weitere Zuschüsse im Sinne billiger Lebensmittel gestattet. Mehrere Nichtregierungsorganisationen sehen die Interessen von Entwicklungsländern beeinträchtigt. Von Seiten kirchlicher Organisationen zum Beispiel heißt es, es sei schwer nachvollziehbar, warum kein weiteres Land umfassende staatliche Maßnahmen ergreifen darf, um Kleinbauern sowie Händler zu stützen und Lebensmittelknappheit zu bekämpfen. Zu Bedenken sind aber auch die Einwände jener Länder, die fürchten, dass sie ihre Produkte nicht mehr absetzen können, weil etwa Getreide durch staatliche Subventionen extrem günstig angeboten wird. Dann wird das Problem von einem Land ins nächste verlagert. Der Kompromiss hat daher mehr positive Seiten als negative - gerade dann, wenn auch die USA und die EU Subventionen abbauen und ihre Märkte öffnen.
Praxis für Konsumenten in Österreich
Praxis für Konsumenten in Österreich
Kernpunkte des Bali-Abkommens sind auch vereinfachte Zollsysteme und eine Öffnung der Industrieländer für Waren aus der Dritten Welt, auch mehr Entwicklungszusammenarbeit. Österreich hat einen hohen Exportanteil und ist sehr von Rohstoffen, von Zulieferungen abhängig. Je einfacher es wird, Waren aus aller Welt zu bekommen und in alle Teile der Welt auszuführen, desto größer ist die Chance sich auf den diversen Märkten zu etablieren. Gelingt es, dann entstehen auch hier neue Arbeitsplätze, die Wirtschaft wächst, Einkommen steigen und nicht zuletzt bekommt der Staat mehr Steuereinnahmen.