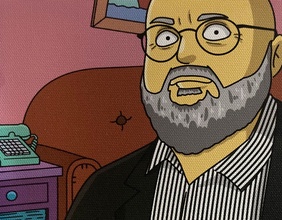Kulturgeschichte der österreichischen Küche
Gastrophilie und eine lange Küchentradition, in der das Erbe der Habsburgerzeit fortlebt, sind Hauptzutaten des österreichischen Selbstverständnisses. Wie es dazu kam, das zeigt der Restaurantkritiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und Dozent am Zentrum für Gastrosophie in Salzburg Peter Peter in seinem neuen Buch.
8. April 2017, 21:58
2012 stellte Slowenien bei der EU den Antrag, unter der Bezeichnung "Krainer" nur noch slowenische Produkte zuzulassen. Prompt titelte die "Kronenzeitung": "EU nimmt uns die Käsekrainer weg". Die Krainer-Krise zeigt exemplarisch den Stellenwert, den Lukullisches in Österreich hat. Für den deutschen Food-Journalisten Peter Peter ist die in den 1970er Jahren erfundene Käsekrainer außerdem das jüngste Beispiel einer weiteren österreichischen Spezialität: die, seine Magenfüller nostalgisch zu verklären.
Zitat
Tatsächlich ist das nationale Basispaket (...) nicht so altehrwürdig, wie es scheint, vor allem die vielbeschworene Habsburgbeziehung steht auf wackeligen Beinen. Andererseits: wenn man sich nicht an Namen festklammert, sind Traditionslinien erkennbar.
Alpine Rezepte in der Renaissance
Manche dieser kulinarischen Traditionslinien gehen weit zurück: Geselchtes gab es schon in der Hallstattkultur und prähistorischer Gerstenbrei lebt im Kärnter Ritschert fort. Die österreichische Küche im engeren Sinn erlebte einen ersten Höhepunkt im Tirol der Renaissance, wo Maximilan I. die Beute seiner Jagdleidenschaft mit eigens aus dem Burgund importiertem Besteck tranchierte. Alpine Rezepte, die 1581 in einem Mainzer Kochbuch erschienen, dürften auf den Ambraser Hof zurückgehen, etwa gefülltes Murmeltier oder Pastete vom Adler:
Zitat
in eine Pasteten eynmachen / daß man den Halß / Flügel und Schwanz darauff macht / daß man sihet / daß ein Adler sey.
Einen bleibenderen Einfluss auf die österreichische Küche hat die Handelsroute über den Brenner hinterlassen: Begriffe wie Marille zeugen davon. Küchentermini, seien sie italienischer oder böhmischer Herkunft - an ihnen wird die identitätsstiftende Funktion, die das Essen für Österreich hat, besonders deutlich, meint Peter Peter. Er erinnert an Karl Kraus' Bonmot von der gemeinsamen Sprache, die Österreicher und Deutsche trenne:
Zitat
(...) wenige denken dabei spontan an Landeshauptmann und Ministerpräsidenten, (...) an Kassa und Kasse. Es sind kulinarische Termini wie Karfiol versus Blumenkohl (...) oder Gespritzter versus Schorle, an denen im Alltag die sprachliche Distanz zum kleindeutschen Brudervolk täglich erneuert wird und sich Österreich seiner kulinarischen, ja implizit kulturellen Suprematie vergewissert.
"Österreichisch" erst nach dem Zweiten Weltkrieg
Mit dem "Freywillig-auffgesprungenen Granat-Apffel Deß Christlichen Samaritan" erschien 1741 erstmals ein Kochbuch, das die österreichische Küchensprache in einem Glossar erklärte – für Peter Peter die Geburtsstunde einer eigenständigen Küchenidentität. Eine ihrer wichtigsten Zutaten, die Mehlspeisküche, war mit der Gegenreformation entstanden, denn im Gegensatz zu den asketischen Protestanten setzte der wieder erstarkte Katholizismus trotz strenger Fasttage auf Gaumenfreuden.
Allerdings wurde lange kein begrifflicher Unterschied gemacht zwischen deutscher und österreichischer Küche: Noch 1858 nannte die Grazerin Katharina Prato ihren Kochbuchbestseller "Süddeutsche Küche". Die Bezeichnung "Österreichische Küche" konnte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzen.
Zitat
Das eng mit der Nationenbildung verzahnte Wortpaar erlebt eine Zwischenblüte nach den napoleonischen Umwälzungen, als Franz I. 1804 das Kaiserreich Österreich ausrief. Zugleich steht der Begriff "Österreichische Küche" immer mehr für die Gesamtzahl aller habsburgischen Völker, während "Wiener Küche" tendenziell eher Deutschnationale ansprach.
Anekdoten und Mythen
Auch die Erste Republik kochte lieber "Wiener Küche" und betonte in ihrer k.-u.-k.-Nostalgie deren Wurzeln in der untergegangen Monarchie. Nicht immer zu recht: Knödeln, zum Beispiel, sind weniger böhmisches Erbe als mitteleuropäisches Gemeingut. Auch das Wiener Schnitzel dürfte keineswegs von Feldmarschall Radetzky aus Mailand eingeführt worden sein, sondern tatsächlich aus Wien stammen. Wie Peter in einem ausführlichen Kapitel darlegt, taucht die geographische Ursprungsbezeichnung allerdings zuerst in Prag und Paris auf.
Peter Peters "Kulturgeschichte der österreichischen Küche" ist ein gelungenes Buch, profund recherchiert, anekdoten- und zitatenreich erzählt, ohne aufs Schlüsse-ziehen zu vergessen. Es geht so manchem kulinarischen Mythos auf den Grund und zeigt auch für einheimische Feinspitze überraschende Zusammenhänge auf.
Ergänzt wird die Kulturgeschichte durch Exkurse zu den einzelnen Bundesländern, abgerundet durch Rezepte aus den verschiedenen Epochen und Regionen. Einige Ungenauigkeiten stoßen allerdings sauer auf, etwa als Suppeneinlage bezeichnete Eiernockerln. Umso mehr als Peter Peter einen Satz der österreichischen Journalistin und Kochbuch-Autorin Eva Bakos zitiert:
Zitat
"Der Wiener empfindet jede Fehlinterpretation seiner Lieblingsspeisen als besonders infame Art der Geschichtsfälschung."
Service
Peter Peter, "Kulturgeschichte der österreichischen Küche", C. H. Beck